|
Filialkirche
St. Jakob in LAUTERBACH
|

Adresse : 85232 Bergkirchen, Am Kreuzweg 10
Lage der Kirche
auf der Landkarte ...
|
Kurzbeschreibung
Die Ortschaft
Lauterbach mit ca. 800 Einwohner liegt an der A8 zwischen den Ausfahrten
Sulzemoos und Dachau.
Das Ortsbild wird vom Schloss Lauterbach und der Jakobskirche geprägt,
die auf einem Moränenhügel errichtet wurden. Von dort
aus hat man eine weite Aussicht ins Voralpenland.
Die erste schriftliche Erwähnung
einer Kirche in Lauterbach (als Filiale der Pfarrei Einsbach)
ist in der Konradinischen Matrikel von 1315 zu finden. Sie
war wohl -zusammen mit dem Schloss- im 13.Jh. errichtet worden.
Die heutige Kirche wurde vor dem
Jahr 1450 im gotischen Stil erbaut. Damals übernahmen
die Familien der v.Egloffstein und der v.Hundt die Hofmark.
Um
1670 hat man das Langhaus abgerissen
und in barockem Stil neu errichtet. Dabei wurde auch der Chor, dessen
Außenmauer stehen blieben, innen barock umgestaltet. Die Decken
der gesamten Kirche wurden von Jörg Zwerger mit einem zarten
Stuck der "Mies-bacher Art" verziert, der den Stil der
Kirche noch heute maßgebend prägt.
|
1680 kam als Grablege der Hofmarksherren eine Gruftkapelle
als südlicher Anbau zum Altarraum dazu. Dort befindet sich
u.a. ein repräsentatives Epitaph für Wiguläus v.Hundt (1514-1588),
den berühmten Rechtsgelehrten, Hofratspräsidenten und politischen
Hauptberater des bayerischen Herzogs Albrecht V. Er war Pfleger zu Dachau
und Geschichtsschreiber.
Der barocke Zwiebelturm im nördlichen Chorwinkel
der Kirche wurde erst 1910 errichtet; bis zu diesem Zeitpunkt hatte
die Kirche einen hohen Dachreiter, der fast mittig auf den Dachbalken aufsaß.
In der Glockenstube hängen
drei Glocken, "zwei neue und eine alte Glocke", heißt
es. Sie wurden 1696 (von Jacob Scohrer) und 1949 (zwei von Karl Czudnochowsky)
gegossen.
Pfarrzugehörigkeit
St.Jakobus Lauterbach
ist seit 1978 eine Filialkirche der Pfarrei Bergkirchen. Früher gehörte
sie über viele Jahrhunderte zur Pfarrei Einsbach. Seit 2013 ist Lauterbach
mit der Pfarrei Bergkirchen Teil des Pfarrverbands Bergkirchen-Schwabhausen.
Die Kirche ist eines von fünf Gotteshäusern im Dachauer Land,
die dem Apostel
Jakobus dem Älteren gewidmet sind.
Die
heutige Kirche ist ein Saalbau
zu vier Achsen mit eingezogenem Chor. Sie wurde in Bau und Ausstattung
nach den künstlerischen Ansprüchen der Grafenfamilie gestaltet,
aber von der Grafenfamilie auch als Begräbniskirche genutzt. Die
Innenausstattung stammt aus der Zeit des Rokoko (um 1760).

zur detaillierten Beschreibung
klicken Sie auf die Ausstattungsgegenstände
Altäre
Am Choraltar (1760) ist zweimal der hl.
Jakobus dargestellt:
- im Hauptgemälde (Altarblatt) kniend mit Pilgerstab, Pilgerflasche
und Muschelemblem,
- im Auszug sitzend, von Engeln umgeben.
Das Altarblatt zeigt links unten, hinter St.Jakobus, die Ansicht der Lauterbacher
Kirche und des Schlosses vor 250 Jahren.
Auch die Seitenaltäre stammen
aus der Zeit des Rokoko (1760)
Der linke Seitenaltar ist der Heiligen Familie geweiht. Auf dem Altarblatt
ist der Knabe Jesus mit seinen Eltern zu Hause dargestellt.
Der rechte Seitenaltar ist der Marienaltar. Mittelpunkt ist ein großes
Madonnengemälde.
Berühmt ist die Kirche
von Lauterbach wegen eines bemalten Fensters
aus der Zeit von 1437 und 1449 hinter dem Hochaltar. Darauf werden eine
Kreuzigungsgruppe, eine Pieta sowie die Heiligen Barbara (mit Turm), Maria
Magdalena (Salbbüchse), Jakobus (Muschel) und Antonius den Einsiedler
(Kreuz) dargestellt.
Auf der Südseite
des Langhauses ist die besonders prächtige Rokokokanzel
aus der Zeit um 1760 angebracht.
Unter der 300-jährigen
Eichenallee neben der Kirche ist ein Kreuzweg
eingerichtet, der als einer der schönsten im Dachauer Land gilt.
In
der Kirche werden folgende Heilige auf Bildern oder als Figuren
gezeigt (und hier besonders verehrt):
• St.Anna
selbdritt-Figur- in der Gruftkapelle (18.Jh)
• St.Antonius
der Einsiedler mit Kreuz in der Hand, im alten Fenstergemälde
(1449)
• St.Barbara
mit Turm, im alten Fenstergemälde (1449)
• St.Franziskus
v. Assisi mit Kruzifix, im Kirchenschiff (18.Jh)
• St.Franz
Xaver im Chorrock, auf dem rechten Altar (1760)
• St.Georg
mit Spieß und Drachen, in der Gruftkapelle (18.Jh)
• St.Jakobus mit Pilgerstab im Altarauszug
des Choraltars (1760)
mit
Pilgerstab und -flasche auf dem Altarblatt
des Choraltars (1760)
mit weißer Muschel, im alten Fenstergemälde
(1449)
• St.Johannes
Apostel, mit Kelch, aus dem eine Schlange kriecht, auf dem linken
Altar (18.Jh)
mit
Maria unter dem Kreuz, im alten Fenstergemälde
(1449)
• St.Johannes
der Täufer mit Kreuzstab und Lamm, auf dem linken Altar
(18.Jh)
• St.Joh. Nepomuk
mit einem Kruzifix in der Hand, auf dem rechten Altar (1760)
• St.Josef mit Jesuskind
auf dem Arm und Lilie in der Hand, im Kirchenschiff (18.Jh)
als
Teil der Heiligen Familie,
auf dem linken Altarblatt (1869)
• St.Magdalena
mit Salbbüchse, im alten Fenstergemälde (1449)
• St.Maria als Pieta-Halbfigur
im alten Fenstergemälde (1449)
mit
Johannes unter dem Kreuz, im alten Fenstergemälde
(1449)
als
Teil der Heiligen Familie,
auf dem linken Altarblatt (1869)
mit
Jesuskind, auf
dem rechten Altarblatt
als
Mater dolorosa, unter
dem Kanzelkreuz (18.Jh.)
Die typischen Bauernheiligen St.Leonhard, St.Sebastian, St.Antonius, St.Isidor
und St.Notburga fehlen; auch daran sieht man den eher höfischen Charakter
der Kirchenausstattung.
Baudenkmal
Die Kapelle
gehört zu den schützenswerten Baudenkmälern. In der vom
Landesamt für Denkmalpflege herausgegebenen Liste der Baudenkmäler
in Bergkirchen 36)
wird
sie mit folgenden Worten beschrieben: "Aktennummer: D-1-74-113-20;
Am Kreuzweg 10; einschiffig mit nicht eingezogenem, dreiseitig geschlossenem
Chor, im nördlichen Winkel mit Oktogon und Zwiebelhaube, Chor im Kern
spätgotisch, Langhaus um 1670, Turm 1910; mit Ausstattung; südlich angebaut
Grabkapelle der Grafen von Hundt, 1680; Ostzug der Friedhofsmauer, mit
Pforte zum Schloss, wohl 17. Jahrhundert".
|
Was
noch interessiert...
Gottesdienstzeiten
erfahren Sie auf der Internetseite des Pfarrverbands Bergkirchen-Schwabhausen.
Klicken Sie hier...
....................................................................................
Glockengeläute
Von den Glocken der Kirche gibt es eine Audioaufnahme im Internet
bei Youtube 27).
Wenn Sie das Glockengeläute hören möchten,:
klicken
Sie hier...
Der Bergkirchener Arbeitskreis
Hörpfade hat über den Kreuzweg außerhalb
der Kirche einen Bericht von dreieinhalb Minuten Dauer erstellt.
Wenn Sie ihn hören möchten, klicken
Sie hier..
|
Ausführliche
Beschreibung
mit ikonographischen und kunsthistorischen
Hinweisen
Wann die Ortschaft Lauterbach
(Bach mit trinkbarem Wasser) erstmals schriftlich erwähnt wurde, ist
schwer festzustellen, weil es im näheren Umkreis mehrere Lauterbach
gibt. In einer Urkunde, die zwischen 926 und 937 ausgestellt wurde,
tauschte Bischof Wolfram von Freising (926-937) Besitzungen zu Sickenhausen
und Figlsdorf (Landkreis Freising) gegen solche in "Lutrinpah".
Dabei könnte es sich um unser Lauterbach oder um Lauterbach bei Fahrenzhausen
gehandelt haben. Ganz sicher wird Lauterbach im Landkreis Dachau in einer
Scheyerner Urkunde aus dem Jahr 1220 genannt.
 |
Die
Geschichte des Orts ist eng mit der der Schlossherren verbunden. Das
waren (vom 13.Jh) bis 1439 ein Zweig der Grafen von Dachau ("Dachauer
auf Lauterbach") und seither (durch Einheirat) ununterbrochen
die Familie v.Hundt auf Lauterbach (seit 1703 im Grafenstand).
Das Schloss, die Burg, wurde um 1550 neu gebaut. Diesen Zustand stellt
Apian auf seiner Karte von 1568 (siehe links) dar. Ein rechteckiges
hohes Haupthaus ist darauf, von einer dicken Ringmauer umschlossen,
deren vier Ecken mit Wehrtürmen verstärkt sind. 10) |
Im Mittelalter
hat Lauterbach wohl aus zwei getrennten Siedlungen bestanden. Der nordwestliche
Teil von Lauterbach führte bis ins 15.Jh. den selbstständigen
Namen Eschelhof. Er war eben mit eigener Flur ausgestattet und durch den
Bach deutlich vom Hauptort getrennt.
35)
Als
1818 in Bayern aus den 1808 eingeführten Steuerdistrikten die politischen
Gemeinden gegründet wurden, entstand Lauterbach durch eine Abtrennung
der landgerichtlich verwalteten Orte (insbes.Kreuzholzhausen) im 1808
errichteten Steuerdistrikt Lauterbach. Damit entsprach das Gemeindegebiet
dem ehem. Hofmarkbezirk Lauterbach. Die neuen Gemeinden mussten mindestens
20 Familien aufweisen können; das war hier der Fall..
12)
Seit 1. Mai 1978 ist Lauterbach Teil der Großgemeinde Bergkirchen.
Geschichte
der Kirche
Pfarrzugehörigkeit
Früher
gehörte das Dorf über viele Jahrhunderte zur Pfarrei Einsbach;
1978 wurde es nach Bergkirchen umgepfarrt.
Seit 2013 ist Lauterbach mit der Pfarrei Bergkirchen Teil des großen
Pfarrverbands Bergkirchen-Schwabhausen.
Konradinische Matrikel von 1315
Eine Kirche in Lauterbach ist in der Konradinischen
Matrikel von 1315 (als Filiale von Einsbach) erstmals erwähnt.
Die Kirche ist eines von fünf Gotteshäusern im Dachauer Land,
die dem Apostel Jakobus dem Älteren gewidmet sind. Diese häufige
Namensgebung mag daran liegen, dass diese Kirchen in einer Zeit erbaut
wurden, in der dieser Apostel besonders verehrt wurde. Vom 10. bis zum
15. Jahrhundert zog die Wallfahrt zum Grab dieses Heiligen in Santiago
de Compostela in Spanien nämlich mehr Pilger und Gläubige an
als Rom oder Jerusalem. Vielleicht führte auch ein Pilgerweg durch
das Dachauer Land nach Spanien.
Gotischer Neubau 1449
Die Kirche wurde wohl Anfang des 15. Jh. im Stil der Gotik neu erbaut.
Die Steine dazu sollen von der 1402 beim Zötzelhof (Landkreis Fürstenfeldbruck)
abgerissenen Burg stammen. Der Rohbau der Kirche dürfte jedenfalls
spätestens um 1449 gestanden sein, weil Veit von Egloffstein, zwischen
1437 und 1449 das Fenster hinter dem Choraltar gestiftet hat.
Sunderndorfer'sche
Matrikel 1524
Die Sunderndorfer'sche
Matrikel von 1524 spricht von "s.Jacobi in Lauterwach"
als einer der vier Filialkirchen der Pfarrei Einspach, zu der auch noch
zwei Kapellen gehörten. Diese Matrikel nennt erstmals den Patron
der Kirche, den hl.Apostel Jakobus den Älteren.
Visitationsbericht von 1560
11)
Im Jahr 1560 ordnete der Freisinger Bischof Moritz von Sandizell auf Druck
des bayerischen Herzogs Albrecht V. eine Visitation, eine umfassende Überprüfung
aller Pfarrer und Pfarreien an.
Die Visitation wurde durch bischöfliche und durch herzogliche Bevollmächtigte
durchgeführt. Grund war die durch die Reformation Luthers (1517)
entstandene religiöse Unruhe, die jedenfalls in Teilen des Bistums
zur Zerrüttung des geistlichen Lebens geführt hatte. Durch die
Visitation wollte der Bischof einen detaillierten Einblick in die religiöse
Situation der Pfarreien gewinnen. Insbesondere sollte festgestellt werden,
ob die Pfarrer und die Gläubigen noch die katholische Lehre vertraten
oder der neuen Lehre anhingen. Daneben interessierte die Prüfer die
Lebensführung der Pfarrer sowie Umfang und Qualität ihrer religiösen
Kenntnisse.
Der neue Einsbacher Pfarrer Castulus Plank bestand die Prüfung. Er
predigte jeden Sonntag und benutzte zur Vorbereitung nur "katholische
Bücher". Er glaubte an die 7 Sakramente (nicht nur an die 2
Sakramente der Protestanten) und hielt den Gottesdienst nach herkömmlichem
Ritus. Sein Privatleben wird vom Kirchenpfleger so beschrieben: "Pfarrer
helt sich wol, ist kain rumorer.... hat ain Köchin, 4 kinder darbei."
Das Pfarrvolk, zu dem auch die Lauterbacher gehörten, ging fleißig
in die Kirche, aber mit dem Zehent "helt es sich gar ubel".
Im Bericht über die Pfarrei Einsbach ist auch die Filialkirche St.Jacobus
in Lauterbach kurz erwähnt. Und zwar,
| |
dass sie in der
Hofmark des Georg Hundt gelegen ist. Der Hofmarksherr habe den Wunsch
der Visitatoren abgelehnt, die Kirchenpfleger oder den Mesner befragen
zu dürfen. Er verbot ihnen, zu kommen. Die Visitatoren hörten
sich daraufhin bei der Bevölkerung um, die aber sagten, dass
die Hofmarksherren die Kirche gut versorgten und das Gebäude
jetzt (1560) sogar erweitern wollten. Jeden 3.Sonntag hielt der Pfarrer
in Lauterbach die hl.Messe, die übrigen Sonntage in Einsbach.
Befremdlich ist die Schlussbemerkung, die Visitatoren hätten
die Kirche bei der vorgeschriebenen Inaugenschein-nahme (in oculari
inspectione) "nit gefunden". Da scheint wohl auch der
Hofmarksherr dagegen gewesen zu sein. Der wollte keine Kontrolleure
in seinem Gebiet. Immerhin können wir dem Bericht entnehmen,
dass zumindest der Plan bestand, die Kirche Ende des 16.Jh. zu erweitern.
Ob das geschehen ist, wissen wir nicht. |
Wenn Sie
den ganzen Text des Visitationsberichts über die Pfarrei Einsbach lesen
möchten, klicken sie
hier...
Dreißigjähriger Krieg
Wie stark der Ort Lauterbach und seine Kirche im Dreißigjährigen
Krieg gelitten haben, geht aus den Unterlagen nicht direkt hervor. Das
Schloss jedenfalls wurde am Ende des Krieges niedergebrannt; davon kündet
das Bild des Malers Adam Holzmayr in der Jobkapelle in Bergkirchen. Die
Zahl der noch bestehenden Bauernhöfe sank während dieser Zeit
von 29 (1631) auf 24 (1649). 5 Höfe wurden wohl niedergebrannt. Der
rasche Neubau des Langhauses nach dem Krieg spricht für eine Beschädigung
der Kirche. Vor allem, wenn die Baupläne aus dem Ende des 16.Jh.
verwirklicht worden sein sollten.
Barockisierung
1670
|
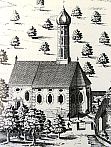
Nordseite
|
Um das Jahr 1670 (andere
Quelle: 1645) wurde das Langhaus der Kirche neu errichtet. Der gotische
Chor blieb erhalten, wurde innen aber barock umgestaltet. Der reiche,
aber zarte Deckenstuck orientierte sich nicht an den Formen der
Wessobrunner
Schule; er wurde vielmehr um 1680 in Miesbacher
Art gefertigt. Nach Robert Böck 20)
und Michael Andreas Schmid 30)
stammt er von der Stuckatorenfamilie
Zwerger aus Schliersee. Georg Zwerger kann für sich
in Anspruch nehmen, den Typ der Wandpfeilerhalle in den ländlichen
Kirchenbau eingeführt zu haben. 23)
Links und rechts sehen Sie Bilder des Geographen und Kupferstechers
Michael Wening aus der Zeit um 1700. Auffallend ist der außergewöhnlich
hohe Dachreiter, also ein Kirchturm, der mitten auf den Dachbalken
aufsitzt. Der Druck auf die Balken muss erheblich gewesen sein.
|

Südseite
|
1680 wurden
südlich an die Kirche eine Sakristei und eine
Gruftkapelle angebaut. Bis dahin hatte die Kirche den Hofmarksherren
(seit 1449 die Familie Hundt) als Begräbnisstätte gedient.
Die Hundts hatten sich immer als die Patronats-herren dieser Kirche
gefühlt und sehr viel für den Unterhalt und die reichhaltige
Ausstattung "ihrer Kirche" getan. |

klicken Sie auf die
kleinen Bildchen |
1707 kam der
Fürstbischof von Freising, Johann Franz v.Eckher von Kapfing,
um die Kirche mit ihren damals vier Altären einzuweihen. Dieser
kunstsinnige Bischof regierte sein Bistum von der Reisekutsche aus;
er unternahm viele Pastoralreisen selbst in kleinste Dörfer seines
Bistums. In seiner Regierungszeit von 1695 bis 1727 weihte er 174
Kirchen (darunter Pellheim, Hirtlbach, Ebertshausen, Straßbach,
Jarzt und Kollbach) und ca. 1.100 Altäre. |
 |
Weiheurkunden
In Lauterbach weihte der Fürstbischof am 27.Sept. 1707 insgesamt
vier Altäre. Der vierte Altar stand in der Gruftkapelle; er ist
nicht mehr erhalten. Über die Weihe eines jeden Altars wurden
Urkunden ausgestellt. Die Lauterbacher haben alle vier Urkunden
in einen Bilderrahmen gesteckt und in die Gruftkapelle gehängt.
Die Altäre wurden
1) zu Ehren des hl.Jakobus mit Reliquien von St.Festinus und St.Crescentia
2) zu Ehren von St.Maria mit Reliquien von St.Theodorus Prospeus und
St.Modestus
3) zu Ehren des hl. Innocenz mit Reliquien der Heiligen Felicimus
und Innozenz
4) Beatam Virginem Mariae sine macula concepta (Mariä unbefleckte
Empfängnis) geweiht. |
Schmidt'sche Matrikel 1738/40
In den Jahren 1738/40 besuchte der Freisinger Kanonikus (Domherr) Schmidt
alle Pfarreien der Diözese Freising und beschrieb in der nach ihm
benannten Matrikel auch die Filialkirchen (Schmidt'schen
Matrikel). Zur "Ecclesia filialis s.Jacobi in Lauterbach"
bemerkte er, die Kirche sei ein ansehnliches Bauwerk mit vier Altären.
Der Choraltar war auch damals dem hl. Jakobus geweiht. Die Seitenaltäre
hatten die Jungfrau Maria und den hl. Innocenz zum Patron. In der Gruftkapelle
stand ein weiterer Marienaltar, der der unbefleckten Empfängnis gewidmet
war. Gottesdienste wurden jeden vierten Sonntag gehalten sowie an Weihnachten,
am Sonntag nach Weih-nachten, am Dreifaltigkeitsfest (Sonntag nach
Pfingsten), an Oster- und Pfingstmontag, an allen Marienfesten außer
an Lichtmess, an den Festen der Heiligen Johannes und Paulus, Blasius,
Stephanus und Innocentius. Das Kirchweihfest fiel auf den Sonntag vor
Michaeli (29.Sept). Messgewänder waren in ausreichendem Umfang vorhanden.
Neben der Kirche war im Friedhof ein Beinhaus errichtet. Im hohen Dachreiter
hingen zwei geweihte Glocken. Die Einnahmen und Ausgaben der Kirche verwalteten
der Pfarrer von Einsbach und der Hofmarksherr von Lauterbach, der erlauchtigste
Herr Comes von Hundt. Der Bericht schließt mit dem einzigen Satz
in deutscher Sprache: "Das Vermögen dises Gottshauses hat in
letzter Rechnung 3693 fl. (=Gulden), 50 kr.(=Kreuzer) und
1 1/2 hl.(=Heller) ausgeworffen". Das war für eine Kirche
dieser Größe ein sehr hoher Betrag.
Um 1760 wurde die Kirche
im Rokokostil neu ausgestattet.
|
Beschreibung
1874 32
In der Statistischen Beschreibung
des Erzbistums München und Freising vom Beneficiaten an der
Domkirche Anton Mayer aus dem Jahr 1874 wird auch die Kirche von
Lauterbach als Filiale von Einsbach erwähnt. Zu ihr gehörten
260 Dorfbewohner (Seelen), die in 49 Häusern wohnten. Lauterbach
war damals vor Überacker und Einsbach der größte
Ort der Pfarrei. Über das Kirchengebäude von Lauterbach
schreibt Mayer: "Erbauungsjahr unbekannt. Stillos. Geräumigkeit
beschränkt, zu schmal. Kuppel-Thurm: Dachreiter mit 2 Glöckchen
von den Jahren 1694 und 1696. Gießerei Joh.G.Scharrer in München.
4 Altäre. Orgel mit 4 Registern. Eine nach der Kirche hin offene,
an sie angebaute Capelle enthält die Familiengruft der Grafen
v.Hundt. Cemeterium (=Friedhof) ohne Capelle. Gottesdienste:
regelmäßig abwechselnd mit Palsweis und Ueberacker, sohin
jeden 3.Sonntag; außerdem an vielen Festtagen. Stiftungen:
12 Aemter mit Vortrag, an Sonntagen durch den Coadjutor zu halten,
6 Jahrtage, 18 Jahrmessen und 8 Quatembermessen (Quatembertage sind
Mi, Frei, Sa nach: 1.Fastensonntag, Pfingsten, 3.Septembersonntag
und 3.Adventssonntag) . Meßner ist derzeit der Schuhmacher
des Ortes, Cantor der Lehrer in Einsbach. Kirchenvermögen rd.
5000 Gulden".
|
 Kirche von Westen
Kirche von Westen |
Beschreibung 1895 29)
Die Kirche
St.Jakobus in Lauterbach ist auch im Verzeichnis der Kunstdenkmale des Königreichs
Bayern erwähnt, dessen Dachauer Teil 1888 von Prof. Gustav von Bezold
und Dr. Georg Hager bearbeitet und 1895 von Betzold und Dr. Riehl im Auftrag
des Königl.Bayer. Innenministeriums herausgegeben wurde. Ich habe den
umfangreichen Text, der die Kunstgegenstände nach dem Stand am Ende
des 19.Jahrhunderts aufzählt und bewertet, auf eine eigene Seite gelegt.
Wenn Sie den Text lesen möchten,
klicken Sie hier...
Bau des Kirchtums 1910
Im Jahr 1906 musste die Kirche gesperrt werden, weil der Kirchturm, der
im eigentlichen Sinne ein Dachreiter
war, baufällig geworden war. Als man die Kirche im 17.Jh neu errichtete,
hatte man kein Geld, um einen richtigen Kirchturm mit eigenem Fundament
bauen zu lassen. Deshalb setzte man einen -allerdings recht hohen- Dachreiter
(ebenfalls mit Zwiebel) auf, der auf einem Eichenbalken im Dachbereich
gründete. Dieser Balken war im Laufe der Jahre morsch geworden.
Es dauerte noch bis 1910, bis man den heute noch stehenden Kirchturm im
neubarocken Stil errichtete. Während der Zeit der Sperrung fanden
die Gottesdienste in der Schlosskapelle statt. 26)
Statistik
In den alten Matrikeln,
Beschreibungen und Zeitungsberichten werden immer wieder Zahlen genannt,
die sich auf die Bevölkerung, die Seelen (Pfarreiangehörige),
Häuser, Anwesen, Gebäude oder Familien beziehen. Leider ist
die Bezugsgröße dieser Zahlen sehr unterschiedlich; sie sind
deshalb nicht immer vergleichbar. So beziehen sich die Werte teils auf
die Ortschaft oder die Gemeinde, teils auf die Pfarrei bzw. den Filialkirchenbezirk.
1852: Gemeinde Lauterbach mit 67 Familien und 323 Einwohnern
03)
1867: Gemeinde mit 308 Einwohnern, 83 Gebäuden 04)
Ortschaft mit 253
Einwohnern in 68 Gebäuden (dazu Grub 17/7, Hopfenau 17,/7, Rodelzried
21/4)
1874: Filialkirche mit 260 Gläubigen in 49 Häusern.
1901:
Ortschaft mit 347 Einw.
2020:
Ortschaft mit 800 Einw.
Berichte aus der Pfarrei
Die Dachauer Zeitungen haben in den letzten 120 Jahren immer wieder aus
dem Pfarrleben berichtet. Diese oftmals in blumiger Sprache verfassten
Berichte beschäftigen sich nicht unmittelbar mit dem Kirchengebäude,
vermitteln aber einen ergänzenden Eindruck aus der damaligen Zeit.
Meist werden Primizen, Jubiläen oder Abschiedsfeiern von Pfarrern
oder Fahnenweihen beschrieben. Wenn Sie die Berichte lesen möchten,
klicken Sie hier...
Baubeschreibung
Die Kirche liegt auf einem Hügel am südlichen Dorfrand, westlich
vom Schloss der Familie Hundt. Sie ist von einem ummauerten Friedhof umgeben.
|
Der zweiachsige Chor
(um 1440) ist nicht eingezogen
und schließt
in drei Achteckseiten. Außen werden die Mauern durch Stützpfeiler
gehalten.
Das Langhaus, das Kirchenschiff, aus der Zeit um 1670 besitzt
vier Achsen.
An der südwestlichen Langhausseite befand sich in der Barockzeit
(um 1680) ein heute zugemauertes Portal mit Pilastern
und Sprenggiebeln;
man kann es noch deutlich erkennen. Nach Max Gruber 33)
handelte es sich um einen "korbbogigen
Eingang, beidseits Pilaster
mit gesprengtem und
verkröpftem Giebel bei rundbogiger Mittelnische
mit kleinen seitlichen Pilastervorlagen,
darüber rechtwinkliger Giebel, bekrönt von kielbogenartigem
Aufsatz".
Östlich von diesem
ehem. Barockportal ist ein bildstockähnliches Mauerwerk in
die Langhauswand eingelassen.
|
 Alter
Eingang
Alter
Eingang |
Die Fenster der Kirche mit darüberliegenden
querovalen Blendnischen sind oben und unten gerundet; an der Westseite
ein Rundfenster, in der östlichen Chorseite das berühmte gotische
Fenster mit originalem spitzbogigem Maßwerk.
Südlich von Chor und Langhaus steht seit
1680 die Gruftkapelle. Daneben ist die Sakristei angebaut.
Der mit Kupfer gedeckte Zwiebelturm an der Nordseite des Chores
wurde erst 1910 errichtet, nach einem Plan des Dachauer Bezirksbaumeisters
Scholz. Im Baustil wurde er dem barocken Langhaus angeglichen. Vorher
besaß die Kirche nur einen Dachreiter
(ebenfalls mit Zwiebel), der 1906 baufällig geworden war. Die unteren
Geschosse des Turms haben einen quadratischen Grundriss; die oberen Geschosse
sind achteckig. Geschmückt ist die Turmfassade durch ein Gurtgesims
und hochovale Blendnischen.
In der Glockenstube hängen drei Glocken, "zwei neue und
eine alte Glocke", heißt es 25).
• Die älteste und zugleich kleinste Glocke stammt aus
dem Jahr 1696. Sie hat aufgrund ihres Alters und ihrer geringen Größe
die
Ablieferungspflicht in den beiden Weltkriegen überstanden.
Die Glocke ist der Gottesmutter geweiht. Die Aufschrift lautet:
"Ave Maria gratia plena dominus tecum"; John
Jacob Scohrer in Minhcen goss mich 1696".
• die mittlere, 300 kg schwere Glocke ist dem Kirchenpatron
Jakobus geweiht. Die Aufschrift lautet: "St.Jacobus Patronus
Ecclesiae nostrae tueator nos 1949". Sie
wurde von Karl Czudnochowsky aus Erding gegossen und im Dezember 1949
geweiht.
Über diese Glockenweihe hatte der Dachauer Anzeiger
vom 22.12.1949 08)
berichtet.
Wenn Sie den Bericht lesen möchten, klicken
Sie hier...
• Auch die große, 500 kg schwere Glocke wurde von Karl
Czudnochowsky in Erding 1949 gegossen. Aufschrift: "Christus rex
totius mundi donet nobis pacem".
Das Glockengeläute ist auch unter Youtube zu hören 27):
klicken
Sie hier...
Früher
besaß Lauterbach auch eine von Johann Lorenz Kraus, München
im Jahr 1782 gegossene Glocke. Sie wird wohl in einem der beiden Weltkriege
für Kriegszwecke eingeschmolzen worden sein.
|
|
Hinweis:
Die so typisch bayerisch-barock anmutende Zwiebelform der Bedachung
von Kirchtürmen -auch welsche Hauben genannt- stammt aus dem
Orient. Sie wurde zuerst von den arabischen Baumeistern als Weiterentwicklung
der Kuppeln von Hagia Sophia und Grabeskirche verwendet. Das erste
Bild kam Ende des 15.Jh mit dem Buch "Pilgerreise in das Heilige
Land" von Bernhard von Breitenbach nach Europa. Es enthielt einen
Holzschnitt der im 7.Jh errichteten Moschee auf dem Tempelberg in
Jerusalem (Felsendom). Breitenbach glaubte, die große zwiebelförmige
Kuppel stamme noch vom Tempel Salomons und verband mit ihr die Vision
vom himmlischen Jerusalem. Jörg von Halsbach war der erste Baumeister
unserer Gegend, der Zwiebeltürme plante: die Münchner Frauentürme.
Damals war die Zwiebel als Bauform schon im Italien der Renaissance
sowie insbesondere in Russland verbreitet. Die Zwiebeln der 1560
errichteten Basiliuskathedrale in Moskau ähneln unseren Zwiebeln,
die vor allem nach dem 30jährigen Krieg errichtet wurden,
mehr als die byzantinischen Kuppeln. Ihre Form -unten bauchig, oben
spitz- passte wunderbar zur Kunstauffassung und zum Lebensstil des
Barock und galt "als Synthese aus der Bewegung ins Übersinnliche
und dem Verharren in den Wölbungen des Sinnlichen". 31)
Wenn Sie die Zwiebeln auf den Kirchtürmen im Dachauer Land vergleichen
möchten, klicken Sie hier...
|
Das unmittelbar angrenzende
ehemalige Schulhaus ist mit der Kirche verbunden. Über einen
Durchgang im ersten Stock gelangt man zur Empore der Kirche, auf der die
Armen-Schulschwestern, die den Lehrbetrieb übernommen hatten, der
Messe beiwohnen konnten.
An der Südwestseite der Kirche befindet sich ein großes Grabdenkmal
der Gräfl. Familie von Hundt aus dem 19. Jh., das an der Stelle
des früheren Eingangsportals errichtet wurde.
Daneben sind in die
Außenmauer viele weitere Epitaphe eingelassen:
Die Texte auf
den Epitaphien können Sie (soweit entzifferbar) lesen, wenn Sie auf
die einzelnen Bildchen klicken.
Missionskreuz
|
An der äußeren Ostseite des Altarraums ist zwischen den
Stützpfeilern eine Gedenkstätte eingerichtet, die mit einem
steinernen Missionskreuz
aus dem Jahr 1844 geschmückt ist. Auf dem hohen Sockel weisen
Inschriften in drei Spalten auf Verstorbene der Familie Röckhel
hin. In die Stützpfeiler sind weitere vier Epitaphe eingemauert.
|
|
Am
unteren Ende des Kreuzes ist eine Inschriftentafel befestigt, auf
der der Grund für seine Errichtung steht:
" Missions-Ablaß.
Papst Gregor 16. ertheilte durch ein Breve vom 21.Mai 1844 jedem Christgläubigen
einen Ablaß von 7 Jahren und 7 Quadragenen, welcher ... 7 Ave
Maria zu Ehren der 7 Schmerzen Mariä betet und Reue und Leid
über seine Sünden erweckt". |
|
Texte auf dem Sockel:
"Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt
bin."
"Im Jahre des Herrn 1841 am 28ten Juni verschied in ihrem 35.Jahre
die gnädige Frau Karoline v. Roeckhel auf Lauterbach, geb.
Gräfin Spreti von Weilbach. sie ruhe sanft im Frieden".
Caroline, geb. am 19.März 1806, heiratete am 4.11.1830 den
Karl Ritter v.Roeckel auf Lauterbach, der bayerischer Kammerjunker
war. 01)
|
|
Im
Jahre des Herrn 1847 am 24ten März verschied in seinem 43.Jahre
Karl August Ritter von Röckhel. K(öniglich) B(ayerischer)
.... Gutsherr auf Lauterbach und Wenigmünchen. Gründer
des Klosters arme Schulschwestern dahier. Ruhe in Frieden.
Im
Jahre des Herrn 1839 am 26ten Jäner verschied in seinem 68.Jahre
Jos. .... ein Reichs-Ritter von Röckhel. K(öniglich) B(ayerischer)
Regierungsrath und ... Direktor. Er ruhe sanft im Frieden.
|
|
Kriegerdenkmal
In der Nähe des Westeingangs,
am Übergang zur früheren Mädchenschule, ist das Kriegerdenkmal
für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs an der Wand befestigt.
Das in neubarocken Formen gestaltete Denkmal aus weißem Marmor
war nach dem 2.Weltkrieg in das Schloss verbracht und erst 2014
wieder an der Kirche angebracht worden.
|
 |
Die letzten Renovierungen fanden
1989 und 2011 (Außenfassade und Turmuhr) statt.
Innenausstattung
Der größte Teil
der Innenausstattung stammt aus der Zeit des Rokoko (um 1760).
Altarraum
Der
Altarraum besitzt noch
das auf Konsolen ruhende alte Gewölbe, das um 1670 barockisiert
worden war 33).
Es gewinnt durch die Stichkappen über den tatsächlichen
Fenstern und den Blindfenstern an Struktur und Tiefenwirkung.
Der reiche, aber zarte Deckenstuck orientierte sich nicht am damals
üblichen Stil der Wessobrunner
Schule; er wurde vielmehr um 1680 in Miesbacher
Art gefertigt 33) .
|

Decke im Altarraum |
Nach Robert Böck 20)
und Michael Andreas Schmid 30)
stammt er von der Stuckatoren-familie Zwerger aus Schliersee.
Georg (Jörg) Zwerger (ca.1640 bis nach 1680) kann für
sich in Anspruch nehmen, den Typ der Wandpfeilerhalle in den ländlichen
Kirchenbau eingeführt zu haben. 23)
|
Hochaltar
/ Choraltar
Der Hochaltar
mit seinem prächtigem Aufbau und Auszug ist in den Chorschluss hineinkomponiert.
Es handelt sich um ein Rokokoretabel
aus der Zeit um 1760 33).
Vier schräggestellte Säulen und Pilaster
tragen ein verkröpftes
und seitlich vorspringendes Gebälk mit Volutengesims
und geschweiftem Auszug. Das Antependium
ist mit grün marmoriertem Holz verkleidet.
Altarauszug
Im prächtigen Altarauszug
ist als Skulptur der Patron der Kirche, St.Jakobus zu sehen. Inmitten
eines Strahlenkranzes hält er ein Buch auf dem Schoß und
den Pilgerstab in der Hand. |
|
Rings um die Figur
schweben Putten und Gewölk. Die Jakobusfigur könnte noch
spätgotisch sein; die Englein stammen aus der Barockzeit. |
Altarblatt
Auch das Altargemälde
(Öl auf Leinwand, aus der Erbauungszeit des Altars) zeigt
den hl. Jakobus, mit Pilgerstab, Pilgerflasche und Muschelemblem
am Umhang. Er kniet vor einem angedeuteten Altar, an dem ein aufgeschlagenes
Buch lehnt. Über ihm halten Putten
Lorbeerkranz und Märtyrerpalme bereit.
|
|
Im Hintergrund
des Bildes (links unten) sind Kirche und Schloss Lauterbach im Zustand
vor 250 Jahren zu
sehen. Interessant
ist auch hier der Kirchturm, der als hoher Dachreiter
mitten auf dem Kirchendach sitzt.
Er gründete auf dem Gebälk des Dachstuhls, das sicher
eine große Belastung aushalten musste.
Im Jahr 1910 wurde ein eigenständiger Kirchturm gebaut.
|
 |
|
| |
Hinweise: Jakobus
der Ältere war der Sohn des Fischers Zebedäus und der ältere
Bruder des Jüngers Johannes. Er zählte neben seinem
Bruder und Petrus zu den drei bevorzugten Jüngern, die bei der
Verklärung Jesu und in seiner Todesangst im Garten Gethsemane
zugegen waren. Der Überlieferung nach verkündete er nach
Pfingsten in der Gegend um Samaria und Jerusalem das Evangelium, bis
er durch König Herodes Agrippa I. von Judäa im Jahr 43 geköpft
wurde; Jakobus war somit der erste Märtyrer unter der Aposteln
(Ap 12, 1 - 2). Der Legende nach setzten Anhänger seine Leiche
in ein Boot, das im Meer herumtrieb und in Galizien, im Nordwesten
Spaniens strandete. Dort wurde er begraben. 800 Jahre später,
zur beginnenden Reconquista (Rückeroberung des maurischen Spaniens
durch die Christen) entdeckte König Alonso II das Grab wieder
und baute eine Kirche darüber. Bald begann die Wallfahrt und
Santiago de Compostela wurde eines der größten Wallfahrtszentren
des Abendlandes. Durch ganz Europa führten feste Wallfahrtswege
dorthin; bis ins 15. Jahrhundert zog der Ort mehr Pilger an als Rom
oder Jerusalem. St.Jakob erhielt seine Attribute (Pilgerkleidung und
Muschel) erst im 13.Jh. Die Pilger erhielten am Ziel damals einen
Hut, der mit einer Muschel geziert war. Zuvor war Jakobus meist mit
einer Schriftrolle abgebildet.
Pilgerflaschen (lat.curcurbita=Kürbis)
sind meist birnenförmige Gefäße, die am Rand zum Durchziehen
einer Tragekordel Ösen haben. Ursprünglich bestanden sie
aus einem ausgehöhlten und getrockneten Flaschenkürbis,
später auch aus anderen Materialien. Da die Pilger auf ihrer
Wanderschaft zu den großen Wallfahrtsstätten der Christenheit
oft menschenleere Gebiete durchquerten, führten sie in der Pilgerflasche
immer einen Labetrunk mit sich. Vom Wallfahrtsort wurden dann meist
mit geweihtem Wasser gefüllte Pilgerflaschen nach Hause mitgebracht. |
Der Tabernakel aus der Rokokozeit
(18.Jh) besitzt einen zweisäuligen Aufbau mit vorgezogenem Gebälk.
Er besteht aus Holz, ist gefasst (=bemalt) und teilvergoldet. Die
zweiflügelige Messingtüre ist 100 Jahre jünger 33) .
Vor ihr steht das Tabernakelkreuz aus der 2.Hälfte des 18.Jh.
Fenster
Berühmt ist die Kirche
von Lauterbach wegen eines Glasgemäldes hinter dem Altar.
|
Veit von Egloffstein,
der damalige Mitbesitzer der Hofmark Lauterbach (neben Hans Hundt),
stiftete das Fenster in der Zeit zwischen 1437 und 1449; es zählt
heute zu den bedeutendsten Fenstergemälden in ganz Oberbayern.
Leider ist es durch den Hochaltar verstellt.
Dass es von Veit von Egloffstein stammt, ist an den vier Wappen
darauf erkennbar, unter denen sich seines, das seiner Frau und seiner
Eltern, nicht aber das der Familie Hundt befindet. Die Wappenschilde
stellen die Wappen der Egloffsteiner und Dachauer, sowie der Egloffsteiner
und Nussberger dar. Veit von Eggloffstein heiratete 1437 eine Tochter
aus dem Geschlecht der "Dachauer auf Lauterbach", wodurch
ihm ein Teil von Lauterbach zufiel, den er 1449 an seinen Schwager
Hundt verkaufte.
Allerdings ist zu Füßen des hl.Antonius ein kleiner weißer
Hund eingearbeitet, der üblicherweise in Kunstwerken zu sehen
ist, die die Fam.Hundt in Auftrag gab.
Die Fenstergemälde
stellen dar: (Vergrößerung per Klick auf blauen Text)
ganz
oben: in der Maßwerkfüllung
eine Muttergottes
mitte
links: die Kreuzigungsgruppe mit
Maria und Johannes
mitte
rechts : die Pieta -Darstellung
mit Leidenswerkzeugen
unten
links: der hl. Jakobus (mit
weißer Muschel) und hl. Antonius der Einsiedler
(mit Kreuz) mit einem Bärenwappen.
unten
rechts: die hl. Barbara (mit Turm) und hl.
Maria Magdalena (mit Salbbüchse).
Die Malereien wurden noch in der musivischen Technik erstellt. Das
Glas wird nicht -wie später- mit Farbe bemalt; die Fenster
sind aus in der Masse durchgefärbten Gläsern in der Art
eines Mosaiks zusammengesetzt. Die Hauptkonturen der Darstellung
werden durch die Bleiruten vorgegeben, die die einzelnen Gläser
verbinden. Die Bleiruten, die an den Berührungsstellen verlötet
werden, bestehen zu 75 % aus Blei und zu 25% aus Zinn.
|

Vergrößerung der
einzelnen Fenster per Mouseklick
|
| |
Hinweise: Antonius
der Einsiedler (250-356) wurde als Sohn reicher christlicher Eltern
geboren; er verkaufte seinen gesamten Besitz und wurde Einsiedler
in radikaler Armut und zunehmender Abgeschiedenheit. Die Schweine,
mit denen er oft dargestellt wird, stehen für seine berühmten
Versuchungen (schöne Frauen, Dämonen). Antonius wird "Vater
des Mönchtums" genannt. Die von ihm geprägte Form des Mönchtums
beruht auf Askese und Zurückgezogenheit, sie steht im Gegensatz
zur (später erlassenen) Regel des Benedikt von Nursia. Antonius
soll 105 Jahre alt geworden sein.
Barbara
ist eine legendäre Person. Das bildschöne Mädchen soll
von ihrem heidnischen Vater, dem reichen Dioskuros von Nikomedia,
während einer längeren Geschäftsreise in einen Turm
geschlossen worden sein, um sie am Heiraten zu hindern. Barbara ließ
im Turm ein Bad bauen, aber nicht wie vom Vater angeordnet mit zwei,
sondern mit drei Fenstern, als Zeichen der Verehrung der Dreieinigkeit.
Als der Vater zurückkam und merkte, dass sie Christin geworden
war, ließ er sie geißeln, mit Keulen schlagen, die Brüste
abschneiden und mit Fackeln brennen. Schließlich
enthauptete der Vater die Tochter selbst, worauf er von Blitz getroffen
wurde. Barbara
gehört zu den 14 Nothelfern. Sie ist Patronin der Bergleute und
-wegen des präzisen Blitzschlags- der Artilleristen.
Maria Magdalena ist aus der Bibel
bekannt. Sie wurde Jüngerin Jesu, nachdem der sie von Besessenheit
befreit hatte (Luk. 8, 2). Magdalena sorgte für Jesu Lebensunterhalt
(Luk.8,3). Sie war auch bei der Kreuzigung Jesu dabei; ihr erschien
Jesus nach seiner Auferstehung (Joh.20,15-17). Ob es sich bei Magdalena
auch um die namenlose Sünderin handelt, die Jesus die Füße
salbte (Luk 7, 37 - 38), wie die Legenden behaupten, ist ungewiss.
Aber meist wird sie mit einer Salbbüchse abgebildet. |
Ewig-Licht-Ampel
Die Ewig-Licht-Ampel
aus der 1. Hälfte 19. Jh. 33) ist im Stil nachklassizistisch.
Sie besteht aus versilbertem Messingblech.
Die Verzierungen sind in Treibarbeit erstellt; dies bedeutet, dass
das Kunstwerk durch Hämmern von der Rückseite her über
einer nachgiebigen Unterlage erstellt wurde. |
 Ewig-Licht-Ampel
Ewig-Licht-Ampel |
Das rote Öllämpchen,
das stets im Altarraum brennt, gilt oft als Erkennungsmerkmal eines
katholischen Gottes-hauses. Es entspricht uralter Tradition, an
heiligen Stät-ten Licht brennen zu lassen als Zeichen der Verehrung
und als Sinnbild des Segens, der von diesem Ort ausgeht. Früher
gab es solche Lichter nur an den Märtyrergräbern. Mit
der wachsenden Verehrung der aufbewahrten Eucharistie hat sich etwa
seit dem 13. Jh der Brauch des "Ewigen Lichtes" vor dem Tabernakel,
in dem das Allerheiligste aufbewahrt wird, herausgebildet. Durch
sein dauerndes Brennen weist es darauf hin, dass in der Kirche geweihte
Hostien aufbewahrt werden. |
Zelebrationsaltar
Der Zelebrationsaltar
hat die Form eines einfachen Tisches. Er wurde um 1970 aufgestellt im
Zuge der Liturgiereform durch die Beschlüsse des 2.Vatikanische
Konzils. Dies bedeutet eine Rückkehr zu den Wurzeln der Eucharistiefeier.
Der Zelebrationsalter ersetzt liturgisch
voll den Hochaltar. 28)
zur Geschichte
der Zelebrationsaltäre: hier
klicken...
Gruftkapelle

Gruftkapelle
|
An der linken Seite des Altarraums
ist der Zugang zur 1680 erbauten Gruftkapelle
der Fam. Hundt, der früheren Hofmarksherren von Lauterbach
und Sulzemoos, die in diesem Anbau die Grablege der Familie einrichteten.
Die Kapelle ist durch
ein schmiedeeisernes Gitter
aus der 1.Hälfte des 18.Jh. 33)
mit zwei Türen abgetrennt. Die Decke der Gruftkapelle ist mit
schönem Stuck ausgekleidet, der nach Ansicht von Kunstexperten
sogar noch feiner gestaltet ist, als im Kirchenraum.
|

Gitter am Zugang
zur Gruftkapelle |
Neben den Epitaphen verdienen in
der Gruftkapelle zwei Figuren besondere Beachtung:
Links
vom Grabstein eine graubraun gefasste Skulptur der Anna
selbdritt aus dem 18.Jh. Die Großmutter Anna mit Kopftuch
hat ihren Enkel Jesus auf dem Arm. Vor ihr steht Maria als Jugendliche.
Anna war nach apokryphen
Evangelien des 2. bis 6. Jahrhunderts die Mutter von Maria und somit
die Großmutter von Jesus.
|
 Anna selbdritt
Anna selbdritt |
Hinweis: Das
Motiv der Anna selbdritt kam erst im 15. Jh. nach Bayern,
kurz bevor Papst Sixtus IV. 1481 den Festtag der Anna in den römischen
Kalender aufnahm. Die Verehrung Annas als Mutter der Jungfrau Maria
erreichte damals ihren Höhepunkt. Die Bezeichnung Anna selbdritt
gibt an, dass Anna selbst wiedergegeben ist und dass sie zu dritt
sind. Anna, die Mutter Marias, wird meistens als reife Frau dargestellt;häufig
mit grün-roter Kleidung, um den Kopf ein Tuch als Zeichen der
verheirateten Frau und um den Hals den Goller, den breiten weißen
Frauenkragen.
|
| |
Meist hat Anna
das Jesuskind und Maria auf dem Arm; manchmal steht Maria zu ihren
Füßen, so wie hier in Lauterbach. Fast immer wird Maria
als Kind oder als junges Mädchen dargestellt. Diese Komposition
gehört zu den sog. anachronis-tischen Bildern, weil bewusst zeitliche
Abfolgen außer Betracht gelassen werden. Das Motiv der Anna
selbdritt ist ein Sinnbild für die Entwicklung, Kontinuität
und Weitergabe des Lebens, für den ewigen Kreislauf der Natur.
Die drei Personen Anna, Maria und das Kind umfassen den gesamten Lebenszyklus
von Jugend über Reife bis hin zum Alter. Sie beinhalten das Gewesene,
das Jetzige und das noch Kommende. In ihnen sind Wandel und Erneuerung
angelegt. |
| Rechts neben dem
Grabstein steht eine Figur von St.Georg
mit dem Spieß in der Hand. Er hat seinen Fuß auf den getöteten
Drachen gesetzt, der als Sinnbild für das Böse gilt (18.Jh).
|

St.Georg |
Hinweis:
Georg war Soldat des römischen Heeres zur Zeit Kaiser Diokletians
und wurde um ca. 304 in Nikodemien oder Lydda enthauptet. Bei uns
wird der hl. Georg vor allem als Patron der Pferde verehrt (Georgiritt).
Meist wird er als Ritter dargestellt, der einen Drachen tötet.
Nach der Legen-de hauste in einem See vor der Stadt Silena in Lybia
ein Drache, dem die Einwohner täglich Lämmer und später
Kinder opfern mussten. Da erschien St.Georg, nachdem er alle Martern
überstanden hatte, gevierteilt und vom Erzengel
Michael wieder zum Leben erweckt worden war. |
| |
Als der Drache auftauchte, schwang Georg mit dem Zeichen des Kreuzes
die Lanze und durchbohrte das Untier, das zu Boden stürzte |
Fenster
in der Gruftkapelle
Im Verzeichnis der Kunstdenkmale des Königreichs Bayern von 1895
sind die Fenster beschrieben:
"In einem Fenster der Hundt'schen Kapelle
das Wappen der Hundt und Rehlinger, von einem Engel gehalten, unter
einem
auf 2 Säulen ruhenden Bogen ; in den Bogenzwickeln
die Kreuzigung und die Auferstehung Christi in sehr kleinen Figuren
(grau in grau mit gelb). Von der unter dem Wappen
befindlichen Jahreszahl ist nur noch übrig M... VIII."
Der Stil des Glasgemäldes deutet auf die
mittleren Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts; da Jörg Hundt, dessen
und Seiner
Hausfrau Wappen hier dargestellt sind, 1566 starb,
so ist 1548 oder 1558 zu lesen. H. 44 cm, br. 40 cm.
Epitaphe
Hinweis: Epitaphe gibt es
in unseren Kirchen erst seit dem 14. Jh. als Gedächtnismal für
einen oder mehrere Verstorbenen in Form einer Steinplatte, die innen
oder außen an der Kirchenwand senkrecht aufgestellt wird. Epitaphe
wurden für diesen Zweck eigens angefertigt und können künstlerisch
aufwändig gestaltet sein; sie sind normalerweise keine früheren
Grabplatten.
Epitaph kommt aus dem Griechischen (Epi bedeutet bei, auf und taphos
bedeutet Grab). Das Epitaph ist trotz seiner Wortbedeutung "beim
Grab" kein Grabmal, weil sich i.d. Regel weder dahinter noch darunter
ein Grab befindet.
Epitaphe in der Gruftkapelle
|

Epitaph für Barbara Hundt
1571
|
Das mit (220 x 108 cm) größte
Epitaph ist auch das prächtigste. Es wurde für die am
15.Mai 1571 verstorbene Barbara
Hundt zu Lauterbach und Falkenstein, geb. Rehling, die Ehefrau
von Georg Hundt, iangefertigt. Der Stein besteht aus Rotmarmor.
Text: "Hir Ligt Begraben des Edlen und Vesten Georgen Hundt
Zu Lauterbach und Falkenstein Eliche Hausfrau Barbara, ein geborne
Rehlingerin die gestorben ist den 15.tag May in 1571. ... got genedig
sein welle".
Interessant
ist die Kleidung der Personen, die vor dem Kreuz knien. Sie
tragen eine Mode für Höhergestellte, die sich aus
der spanischen Hoftracht
entwickelt hatte: Ein einreihig geschlossener Wams mit Stehkragen
und Halskrause, eine geschlitzte Pumphose und Strümpfe.
Spanien hatte zwischen 1550 und 1650 die politische Vormachtstellung
in Europa und war (deshalb) auch in der Mode bestimmend. Dieser
Einfluss ging nach dem Dreißigjährigen Krieg auf
Frankreich über.
|

Frauen in span.Hoftracht
|
|
Unter den Epitaphen in der Gruftkapelle ist das des
Dr. Wiguläus Hundt von Sulzemoos und Lenting (1514-1588)
und seiner Frauen Anastasia von Fraunberg und Ursula von Pienzenau zwar
nicht spektakulär, aber dennoch erwähnenswert (es besteht aus
Schiefer, 111 x 92 cm).
|
Der Verstorbene war ein berühmter
bayerischer Jura-professor; als Geschichtsschreiber verfasste er
historische Werke zur Geschichte des altbayerischen Adels und der
Klöster. Wiguläus war auch
Kanzler an der Universität Ingolstadt und brachte es sogar
zum Hofratspräsidenten und Hauptberater in der bayeri-schen
Politik unter Herzog Albrecht V. Er war es, der 1575 während
seiner Reisen als Geschichtsschreiber auf der Burg Prunn im Altmühltal
einen Teil der Nibelun-genhandschrift fand. Wiguläus starb
1588 und wurde in der Franziskanerkirche in München (an der
Stelle des heutigen Nationaltheaters) begraben. Als diese nach der
Säkularisation (um 1803) abgerissen wurde, brachte man den
Grabstein nach Lauterbach.
|
 Epitaph f. Wiguläus Hundt
Epitaph f. Wiguläus Hundt
|
Text
auf der Grabplatte: "WIGVLEVS HVND A SVLZEMOS ET LENTING IVRISC(onsultus)
NOBILIS BOIVS CVM ANTE MVLTOS ANNOS AB OPT(imis) PRINCIP(ibus) BOIOR(um)
WILHELMO ET ALBERTO IN COSILIV(m) ASCITVS ET AB HOC EIVSDEM SVPREMI
CONSILII PRAESES CREATUS FUISSET, POST VARIOS DOMI FORISQUE NON INFOELICITER
SVSC(entos) LABORES DETATE INGRAVESCENTE LETHI MEMOR: MONUMENTUM HOC
VIRVS SIBI VXORIBVSQUE SVAVISSIMIS A FRAUENBERG AC DOMINA URSULA A
PIENENAU ET POSTERIS P: QUOS QUAESO LECTOR PIIS PRECIBUS VIVOS DETVNCTOSQUE
PROSEQUERE: OBIIT ANNO DOMINI M.DL. XXXVIII AETATIS LXXV." |
Weitere Epitaphe in der Gruftkapelle:
|

1567
|
(Südost)
Barbara Seiboltstorf, geb.Hundt, Hausfrau des Hans Leonhard
von Seiboltstorf zu Ritterswörth, Pflegers
von Kösching, gestorben 1.5.1567,
Rotmarmor (184 x 93 cm)
Darunter das Hundt'sche und Seiboldtstorff'sche Wappen. |
|
|
|
(Nord)
Margareth Traunerin,
Hausfrau von Hans Hundt,
gest. 1466 "an unser lieben Frawn abnt in der fasten"
Rotmarmor (198 x 90 cm). Darunter das Hundt'sche und Trauner'sche
Wappenschild. Das älteste Epitaph ist ein Werk der Münchner
Haldner-Werkstatt.
|
Epitaphe im Kirchenschiff

Jörg
v.Hundt 1566
|
Neben dem rechten Seitenaltar
ist im Kirchenschiff ein 264 x 133 cm großes Epitaph für
den 1566 verstorbenen Freiherrn Jörg
von Hundt eingemauert. Das Grabmal in Lauterbach zeigt einen
Ritter im Harnisch,der wohl
den Verstorbenen darstellen
soll. Die Linke umgreift den Schwertgriff, mit der Rechten stemmt
er einen Streithammer gegen die Hüfte.
Um wen es sich handelt,
gibt der darüber eingravierte Text
kund:
"Anno Domini 1566 an Sant Johans des tauffers
tag (=24.Juni) starb der Edl und urst.Jorg
Hundt zu Lauterbach und Falckenstain dem
Gott genad".
In den Bogenzwickeln: die Wappen der Hundt und der Adlzhofer,
unten: die Wappen der Spiegl und Trauner.
Die Figur wird auch im Buch "Kunstdenkmäler des Königreichs
Bayern" 29)
genannt und als "vorzügliches Werk mit guter Durchbildung
des Kopfes mit wallendem Bart" bezeichnet.
|
 Textkartusche
Textkartusche
auf Epitaph 1566 |
|
|
|

1520
|
An der Nordwand
befindet sich der zum Teil vom linken Seitenaltar verdeckte Grabstein
des Englmair Hundt zu Lauterbach
aus rotem Marmor. Auf ihm ist der im Jahr 1520 Verstorbene in einem
flachen Relief (ganzfigurig, nach links gewandt) dargestellt. Er ist
von einem Maximiliansharnisch geschützt, die linke Hand hat er
am Schwertgriff, die rechte Hand umfasst die Lanze. Zu seinen Füßen
liegen links das Hundt'sche, rechts das Adlzhof'sche Wappen. In den
Ecken des Schriftrandes noch weitere Wappen, darunter auch das Trauner'sche
Wappen. (Maße: 216 x 107). |
Kirchenschiff
/ Langhaus
Die
Bezeichnung des Langhauses als Kirchenschiff ist darauf zurückzuführen,
dass die Kirchenväter die Gemeinschaft der Glaubenden als Schiff bezeichneten,
das die Gläubigen aus dem Sturm der Zeit und den gefährlichen Wogen des
Schicksals rettet.
Decke
Das Langhaus ist von einem Tonnengewölbe
mit Stichkappen
überdeckt. Es ruht auf kannelierten korinthischen Pilastern,
die aber teilweise abgeschlagen wurden.
|
Deckenstuck
Langhaus
|
Wappen
|
Felderungen
und Herzlaub
|
Stuck-Putto
|
Herzlaubverzierung
|
|
Decke und
Stichkappen sind mit feiner, zarter Stuckarbeit der "Miesbacher
Art" überzogen. Auf den Gurtbögen
Herzlaubverzierungen, in den Umrahmungen der Füllungen Draperien,
Festons (Girlanden) und Pflanzenmotive.
In der Deckenmitte das Heilig-Geist-Loch,
das mit einem Strahlenkranz auf blauem Hintergrund bemalt ist.
|
|
Der
Stuck wurde 1680 von der Stuckatorenfamilie Zwerger aus Schliersee
geschaffen.
Auch die Fensterlaibungen
sind mit Stuck verziert.
|

Fensterlaibung
|
Seitenaltäre
Die Seitenaltäre gleichen in
Form und Farbe dem Hochaltar. Sie stehen sehr schräg, um in der relativ
engen Kirche den Blick der Gläubigen zum Hochaltar nicht zu verstellen.
Es handelt sich um zweisäulige Rokokoretabel aus der Zeit um 1760.
Die Antependien
haben eine geschweifte Form und sind grün-rot marmoriert. In den
Predellen
stehen Scheintabernakel. Die Altarblätter sind spätere Nazarenergemälde.
Linker Seitenaltar
|
Altarauszug
Im geschweiften Altarauszug
drei Engelsköpfe vor Gewölk. Sie umgeben einen geflochtenen
Kranz aus Akanthusmotiven,
von dem vier Strahlen ausgehen.
|
 Altarauszug
Altarauszug
|
Quer durch den
Kranz gesteckt und in sich gekreuzt, sind ein Zepter und eine Lilie
zu sehen. |
Altarblatt
Der linke Seitenaltarist
der Heiligen Familie
geweiht.
Auf dem Altarblatt ist der Knabe Jesus mit seinen Eltern zu Hause dargestellt.
Maria kniet mit überkreuzten Armen (Gebetshaltung) hinter
dem Jesuskind, das fromm seine Hände faltet. Josef hält seine
Hand beschützend über dem Kind. Über die Schulter trägt
er den Zimmermannswinkel und eine Axt: ein Hinweis auf seinen Beruf.
|
Das Ölgemälde (auf
Leinwand) wurde von Max Fürst (1846-1917) im Jahre 1869
(sign) im Nazarenerstil
geschaffen.
Max Fürst war Schüler von Johann v. Schraudolph und wie
dieser religiöser Maler. Nach einem Aufenthalt in Rom schuf
er zahlreiche Altargemälde und Wandmale-reien in oberbayerischen
Kirchen. Im Dachauer Land hat er auch die Kirche von Welshofen ausgemalt.
Fürst war auch bekannter Historiker, der u. a. das biographische
Lexikon für das Gebiet zwischen Salzach und Inn ver-fasste.
Seit 1909 war er Ehrenbürger seiner Geburts-stadt Traunstein.
|
 Die
heilige Familie
Die
heilige Familie
|
Die
Verehrung der Heiligen Familie kam im 17.Jh.auf;
und wurde im 19. Jh. wiederbelebt.
1861 hat man den "Verein der christlichen Familie" gegründet,
der von Papst Leo XIII. (1878 bis 1903) stark gefördert und weltweit
verbreitet wurde. Deshalb war das Lauterbacher Gemälde bei seiner
Entstehung 1869 also recht aktuell. In den sozialen Umbrüchen
der beginnenden Industrialisierung wollte die katholische Kirche den
Wert der Familie betonen, stellte die Heilige Familie als Vorbild
vor Augen und förderte ihre Vereh-rung. |
| |
Das Jesuskind ist mit
einem rosaroten Gewand bekleidet. Früher war das die Farbe
für Buben, während Mädchen in Himmelblau gekleidet
wurden. Das entschlossenere und kräftigere Rot war die Farben
der Könige, Rosa, das kleine Rot, war die Farbe der kleinen
Könige, der Buben.
Erst in den 1940er Jahren wandelte sich das Farbklischee. Als Grund
werden genannt:
die blauen Hosen der Handwerker und der Matrosen sowie
der rosarote Winkel, den die homosexuellen KZ-Häftlinge in
der Zeit des Nationalsozialismus tragen mussten. 37)
|
Assistenzfiguren aus dem 18.Jh
sind zwei heilige Johannes, in rot-goldenen Gewändern, das Haupt umgeben
von einem Heiligenschein (Nimbus)
in Form eines Strahlenkranzes:
|

St.Johannes
Baptist
|
Links
der hl. Johannes der Täufer, mit
Kreuzstab und einem Buch mit darauf liegendem Lamm. Der Heilige (ein
Verwandter Jesu) war Bußprediger am Jordan und taufte dort auch
Jesus. Später wurde er auf Wunsch der Herodias, der Geliebten
von Herodes und ihrer Tochter Salome enthauptet. Mit den Worten "Dieser
ist das Lamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt"
hatte Johannes den Messias angekündigt (Johannes 1,29). Deshalb
wird er in der Kunst häufig mit einem Lamm und mit dem Spruchband
"Ecce agnus dei" am Kreuzstab abgebildet.
Rechts der Apostel Johannes,
der sog. Lieblingsjünger Jesu, der mit einem Kelch dargestellt
wird, aus dem sich eine Schlange windet. Der Apostel Johannes,
der unter dem Kreuz stand, war der Bruder des Jakobus'des Älteren
und von Beruf Fischer. Er war erst Anhänger Johannes'des Täufers
und wurde dann Jesu "Lieblingsjünger" (Joh.19, 26). Kennzeichnend
ist die Darstellung ohne Bart. Der Giftanschlag, auf den der Kelch
mit Schlange hinweist, war allerdings auf Johannes den Evangelisten
verübt worden. Das Gift sei in Form einer Schlange aus dem Kelch
gekrochen, heißt es in der Legende. |

Apostel
Johannes |
Johannes der Apostel und Johannes der
Evangelist werden in der Überlieferung und in der Kunst häufig
gleichgesetzt, obwohl es sich um zwei verschiedene Personen handelte.
Rechter
Seitenaltar
Altarauszug
Im geschweiften Altarauszug
sind vor einem Strahlenkranz Lanze und Schwert aus vergoldetem Holz
zu sehen. Dazwischen drei Cheruben (geflügelte Engelsköpfchen).
|
 Altarauszug
Altarauszug
|
|
Altarblatt
|
Der rechte
Seitenaltar ist der Marienaltar. Mittelpunkt ist ein großes
Madonnengemälde im vergoldeten Barockrahmen. Die von sieben
Engels-köpfen umgebene Muttergottes ist in einen blauen Mantel
gekleidet; sie trägt ihr offenes Haar hüftlang.
|

Madonna
|
Auf dem Arm hält
sie über einer Windel das Jesuskind, das sich an die Brust Mariens
schmiegt. Das Gemälde wurde zur gleichen Zeit (vom selben Maler
?) wie das Altarblatt des linken Seitenaltars geschaffen (Öl
auf Leinwand, 19.Jh 33) ).
|
Assistenzfiguren
Assistenzfiguren aus der Zeit um 1760
sind
 St.Franz
Xaver
St.Franz
Xaver
|
- auf der linken Seite Franz
Xaver im priesterlichen Gewand mit Talar, Chorhemd und Stola.
In der Hand hält er den Märtyrerpalmzweig. Das Haupt des
Heiligen ist von einem vielstrahligen Heiligenschein umgeben.
- rechts steht der hl. Johannes
Nepomuk im Strahlenkranz mit seinem Attribut, einem Kruzifix
in der Hand. Nepomuk
ist im Stil eines Domherrn des 18.Jh. mit Talar, Rochett, Mozetta
und Birett bekleidet. Der hier blau eingefärbte Talar, der
von den Füßen bis zum Hals reicht, wird durch viele Knöpfe
geschlossen. Darüber trägt Nepomuk das weiße, spitzengesäumte
Chorhemd und über die Schultern hat er die Mozetta, das Schultertuch
aus Fell, gelegt, das durch eine große Kordel geschlossen
wird und das dem höheren Klerus vorbehalten ist. Eine Kopfbedeckung,
wie z.B. das Birett, fehlt. Der Blick des Heiligen ist nicht zum
Kruzifix, sondern auf die andere Seite nach rechts gerichtet.
|

St.Nepomuk
|
Hinweise: Johannes aus Pomuk,
"ne Pomuk", war Ende des 14.Jh Generalvikar des Erzbischofs in
Prag und machte sich beim König Wenzel wegen seines energischen Auftretens
für die Rechte der Kirche unbeliebt. Der ließ ihn am 20.
März 1393 gefangen nehmen, foltern, brannte ihn selbst mit Pechfackeln,
ließ ihn durch die Straßen schleifen und schließlich in
der Moldau ertränken. Die Legende berichtet, der eigentliche Grund
sei gewesen, dass Johannes, der auch Beichtvater der Königin war, dem
König keine Auskunft über die Sünden seiner Frau gegeben
habe. Das 1215 eingeführte Beichtgeheimnis hat in der kath.Kirche einen
hohen Stellenwert. Der Fundort der Leiche in der Moldau wurde durch eine
Erscheinung von fünf Sternen geoffenbart. Nepomuk ist neben Maria der
einzige Heilige, der mit Sternen geschmückt ist. Die Verehrung von
Nepomuk ist zwar schon seit 1400 nachweisbar; sie war aber nicht sehr umfangreich
und zudem auf Prag beschränkt. Sein Denkmal auf der Prager Karlsbrücke,
das 1693 errichtet wurde, machte ihn zum Brückenheiligen. Erst
als man über 300 Jahre nach seinem Tod, im Jahre 1719, bei der Öffnung
des Grabes in der Prager Veitskirche die Zunge des Heiligen unverwest vorfand,
gewann die Verehrung an Dynamik. Im Jahre 1721 wurde der Kult von Rom anerkannt,
am 19.3.1729 folgte die Heiligsprechung durch Papst Benedikt XIII. Noch
im gleichen Jahr wurde Nepomuk von Kurfürst Karl Albrecht zum Landespatron
von Bayern (18.8.1729) erklärt. Die Jesuiten förderten die Verehrung
kräftig und nach kurzer Zeit stand die Nepomukfigur auf vielen Brücken
und in vielen Kirchen. Nepomuk war der Modeheilige der Rokokozeit. Festtag:
16.Mai

zur detaillierten Beschreibung
klicken Sie auf die Objekte
|
|
'
Kanzel
Auf der Südseite
des Langhauses ist die be-sonders prächtige Rokokokanzel
aus der Zeit um 1760 angebracht. Sie ist von der Sakristei
aus durch eine Tür in der Rückwand zu betre-ten.
Auf dem dreiseitigen Kanzelkorb mit abge-schrägten Ecken
sind Kartuschen angebracht. In der mittleren
Kartusche ein Bild des Guten Hirten (Öl auf
Holz). Unter dem Kanzelkorb eine Weintraube.
|

Kanzel 1760
|
Auf dem Schalldeckel sitzen
mehrere Putten; ganz oben bläst ein Engel auf der Posaune. Er
stellt den apokalyptischen Engel dar, der zum Jüngsten Gericht
ruft und über den die Bibel als einzigen berichtet, dass er fliegen
kann 05.
Hinweis: Das Motiv des Posaunenengels geht auf Papst
Leo I. (440-461) zurück, der schreibt, dass von der Kanzel die
Posaune des Evangeliums ertönt.
Kirchenbänke
Die Kirchenbänke
(je 15 Reihen beiderseits des Mittelganges) haben kunstvoll geschnitzte
Wangen im klassizistischen Stil (um 1800).
Weitere drei Reihen stehen in der Gruftkapelle.
Hinweis: Schon vom Frühchristentum an bis in die neueste
Zeit hinein knieten und saßen die Kirchenbesucher in den
Kirchenbänken oder standen im Raum nach Geschlechtern getrennt.
Damit sollte im Gotteshaus eine zu große "sündige"
körperliche Nähe zwischen
|
 Kirchenbankwange
Kirchenbankwange
|
Männern und Frauen verhindert
werden. Dies war in allen drei Hauptkonfessionen (Kath., Evang., Orthodox)
so. In katholi-schen Kirchen sitzen gewöhnlich die Männer
rechts und die Frauen links. Einen eindeutigen Grund für diese
"Seitenwahl" gibt es nicht. Jedenfalls gilt im traditionellen Raumprogramm
der Sakralarchitektur die Epistelseite als Männerseite und die
Evangelienseite als Frauenseite. Seit dem letzten Konzil gibt es diese
Trennung nicht mehr.
Mehr über Kirchenbänke in den anderen Kirchen des Landkreises
finden sie hier...
|
Kanzelkreuz
und Mater Dolorosa

Kanzelkreuz
|
Der Kanzel gegenüber
an der Nordseite hängt ein großes Kruzifix, das sog. Kanzelkreuz
aus dem 18.Jh. 33
Hinweis:
Das Kruzifix heißt Kanzelkreuz, weil es in der Regel
der Kanzel gegenüber an der Wand angebracht ist. Es erinnert
den Prediger an den 1.Korintherbrief (1,3),in dem der hl.Paulus schreibt:
"Wir predigen Christus als den Gekreuzigten". Die Ansprache
soll nicht weltliche Dinge, sondern den Tod und die Auferstehung Christi
zum Inhalt haben. |
|
Darunter steht
die Mater dolorosa
(die Schmer-zensmutter). Maria trägt eine Krone auf dem Haupt,
das von Sternen umkränzt ist. In den verschränkten Armen
hält sie ein Schwert, das an das Simeonwort im Lukasevangelium
(Kap 2,35) bei der Darstellung im Tempel erinnert: "Dir selbst
wird ein Schwert durch die Seele dringen".
Die Figur wurde 1973 von Reinhard
Huber aus Dachau
restauriert. Der Künstler hatte 1967 auch die Apostelfiguren
in der Jakobskirche von Dachau renoviert. |

Mater
dolorosa
|
Heiligenfiguren
im Kirchenschiff
Im Langhaus stehen zwei Heiligenfiguren
aus der Landsberger Luidl-Werkstatt. Figuren der Schnitzerfamilie
Luidl aus Landsberg u.Mering stehen
auch in den Kirchen von Dachau/St.Jakob, Egenburg, Feldgeding, Sittenbach,
Rudelzhofen und Prittlbach.
Die Figuren lagerten lange Zeit auf dem
Dachboden der Kirche, wurden 1935 dort wieder entdeckt und restauriert.
|

Franz
v. Assisi
|
Auf
der linken Seite sehen wir Franz
von Assisi, mit einem Kruzifix im Arm. Der Korpus am Kreuz ist quer
zum Kreuz befestigt. Dem Heiligen war die Verbreitung der Passionsfrömmigkeit
ein Hauptanliegen.
Rechts St.Josef mit dem
Jesuskind auf dem Arm und der Lilie der Keuschheit in der Hand. Joseph
war der Vater Jesu - oder Ziehvater Jesu, da nach altchristlicher
Überzeugung Jesus der Sohn Gottes ist und durch den Heiligen
Geist im Schoß der Jungfrau Maria gezeugt wurde. Joseph stammte
aus dem Geschlecht des Königs Davids, aus dem nach dem Zeugnis
des Alten Testaments der Messias hervor-gehen werde. Er lebte als
Zimmermann in Nazareth. |

St.Josef
|
Unter der Empore ist einer der ältesten
Opferstöcke des Landkreises
aus dem Jahr 1691 zu sehen. Die Jahreszahl steht ganz unten auf dem schön
gestalteten hölzernen Sockel. Der Opferstock ist 72 cm hoch.
|
Opferstöcke gibt es schon seit vielen Jahrhunderten. Im Jahr
1213 ordnete Papst Innozenz III. das Aufstellen von Opferstöcken
an, um damit einen Kreuzzug (den 5.Kreuzzug von 1217 bis 1221) zu
finanzieren.
34
Der Name Opferstock rührt
daher, dass der Opferstock aus einem großen ausgehöhlten
Holzstock besteht, der mit Metall ummantelt ist.
Der Stock ist im unteren Bereich ausgehöhlt. Von dort ist im
massiven Holz ein schmaler Schlitz bis zum oberen Ende herausgearbeitet,
durch den das Geld in die Höhlung fällt.
|

Opferstock
|
Der
Einbruch in den Opferstock ist nahezu ebenso alt, wie die Opferstöcke
selbst. Deshalb muss das Tür-chen, aus dem das Geld vom Mesner
entnommen werden kann, mit schweren Eisenbändern und massiven
Vorhängeschlössern gesichert werden. Zudem wird der Einwurfschlitz
meist mit einem Metallbügel geschützt, der das Fischen
nach dem Geld erschwert.
In den Kirchen des Landkreises
Dachau gibt es viele unterschiedliche, außerordentlich interessante
Opferstöcke. Wenn Sie sich dafür interessieren, klicken
Sie hier..
|
Kreuzwegbilder
und Apostelleuchter

Kreuzwegbilder
|
An den Wänden
des Kirchenschiffs hängen die vierzehn Kreuzwegbilder
aus der 2.Hälfte des 19.Jh. Sie sind 57 x 43 cm groß und
wurden mit Ölfarbe auf Leinwanduntergrund gemalt.
Hinweis: Im späten Mittelalter hielt man dann Kreuzwegandachten
als Ersatz für die Pilgerfahrt ins Heilige Land. Wenn Sie mehr
über die Entstehung der Kreuzwegstationen und seiner Darstellungen
in Kirchen des Landkreises erfahren wollen, klicken
Sie hier.. |
|
Unter den Kreuzwegbildern befinden sich die schmiedeeisernen Apostelleuchter
vor den Apostelkreuzen in Form von Stuckplaketten (18.Jh.
33).
Hinweis: Die Apostelleuchter und Apostelkreuze erinnern an das in
der Apokalypse (21,14) beschriebene himmlische Jerusalem, dessen
Mauern auf zwölf Grundsteinen mit den Namen der zwölf
Apostel errichtet sind. Die Kirche sieht sich als Vorläuferin
des himmlischen Jerusalems.
Auch eine Zusammenstellung von Apostelleuchtern und Apostelkreuzen
unterschiedlicher Formen können Sie sich anschauen. Klicken
Sie hier...
|

Apostelleuchter
|
Der Aufgang zu der
auf zwei schmale Säulen ruhenden Empore liegt außerhalb des
Kirchenraums.
|
|
Die Empore wird durch schöne
Rundfenster, in der
Kunst auch Ochsenauge oder "oeil de boeuf" genannt, erhellt.
Am Emporenaufgang ein Epitaph für Johann Zachel, aus dem Jahr
1861.
|
Orgel
Die
Orgel mit dem schönen
fünfteiligen Prospekt im erweiterten Rokokogehäuse wurde
im Jahr 1913 von Willibald Siemann,
Mch als einmanualiges Werk mit fünf Registern errichtet. Das
Gehäuse ist mit zwei Engeln geschmückt.
|
|
Disposition der Orgel von
1913
(nach Brenninger
-Stand 1975-): 13
Manual (C-f '''): Aeoline 8', Salicional 8',
Lieblich Gedeckt 8', Principal 4'
Pedal: (C-d'): Subbass 16'
Koppeln:
I/I (Sub), I/I (Super), I/P
|
Frühere
Orgeln
der Orgelkenner und Kirchenhistoriker
Dr. Georg Brenninger (1946-2021) berichtete
14) ,
dass hier in Lauterbach um 1770 eine neue Orgel aufgestellt wurde. Sie muss
1829 reparaturbedürftig gewesen sein, weil Karl Frosch aus München
damals einen Kostenvor-anschlagfür eine Reparatur einreichte. Eine
weitere Reparatur war 1911 notwendig. Diese führte Willibald Siemann
aus München durch. Dabei erweiterte er das Gehäuse durch zwei
Seitenfelder und baute ein neues Werk ein. Vom Prospekt vor der Zeit von
1911 existiert im Pfarrhof noch ein Foto .
Wenn Sie sich für
Orgelprospekte interessieren und vergleichen möchten, sollten
Sie hier klicken...
Türen
Interessant
ist ein altes Schloss an der Türe aus Eichenholz, die von der
Sakristei in die Gruftkapelle führt. An dieser Türe befindet
sich neben alten Beschlägen auch ein schmiedeeisernes, teils
ziseliertes Schloss.
|
|
Die Eichentüre am Westeingang soll noch aus dem 18.Jh stammen
33).
Sie ist braun lackiert und mit lilienförmigen
Beschlägen und ebenfalls sehr altem Schloss versehen.
Wenn Sie Interesse an alten Kirchentür-Schlössern haben, klicken
Sie hier...
Krippe
In
der Weihnachtszeit ist vor dem Seitenaltar eine Krippe
aufgebaut.
|
|
Wenn
Sie sich für Krippen in den Kirchen des Landkreises Dachau
interessieren, klicken Sie hier...
|
Nicht
vergessen werden sollte der Kreuzweg
unter der 300 Jahre alten einreihigen Eichen-allee, der als einer
der schöns-ten im Dachauer Land gilt. Er zieht sich von der Kreisstraße
den Kirchberg hinauf; die letzten beiden Stationen sind an der Kirchenmauer
angebracht.
|
 bitte klicken
bitte klicken |
Der Kreuzweg wurde um 1850
von der Grafenfamilie Hundt gestiftet.
Die Gemälde wurden zuletzt nach dem 2.Weltkrieg restauriert.
Die Kosten trug der Kriegsheimkehrer und Bäckermeister Schwank.
Die Bilder haben inzwischen wieder viel von ihrer Farbigkeit verloren.
18)
|
| |
Seinen Ursprung
hat der Kreuzweg im Brauch der Pilger, bei Wallfahrten nach Jerusalem
den Leidensweg Jesu auf der "Via Dolorosa" nachzugehen.
Im späten Mittelalter wurde die Kreuz-verehrung insbesondere
durch den hl.Franziskus von Assisi gefördert, der durch die Stimme
des Gekreuzigten vom Kreuz in St.Damiano zu einem christlichen Leben
bekehrt wurde. Seit dieser Zeit wurden Kreuzwegandachten als Ersatz
für die Pilgerfahrt ins Heilige Land abgehalten. Auch weil man
das Heilige Land nur noch unter erschwerten Bedingungen erreichen
konnte. Aber die Kreuzwegstationen waren immer im Außenbereich,
oft Anhöhen hinauf, aufgestellt. Der erste Kreuzweg in Deutschland
entstand 1503 in Nürnberg. Erst um 1730 wurden die Kreuzwegstationen
in die Kirchen hinein verlegt. |
|
|
|
|
|
|
|
1.
Station
Jesus wird von Pilatus
zum Tod verurteilt
|
2.
Station
Jesus nimmt das Kreuz
auf seine Schultern
|
3.
Station
Jesus fällt zum ersten Mal
unter dem Kreuze
|
4.
Station
Jesus begegnet
seiner Mutter Maria
|
5.
Station
Simon v.Cyrene hilft
Jesus das Kreuz tragen
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
Station
Veronika reicht Jesus
das Schweißtuch dar
|
7.
Station
Jesus fällt zum zweiten Mal
unter dem Kreuze
|
Klicken
Sie auf die Bilder
|
8.
Station
Jesus tröstet
die weinenden Frauen
|
9.
Station
Jesus fällt zum dritten Mal
unter dem Kreuze
|
|
|
|
|
|
|
|
10.
Station
Jesus wird seiner
Kleider beraubt
|
11.
Station
Jesus wird ans
Kreuz geschlagen
|
12.
Station
Jesus stirbt am Kreuz
|
13.
Station
Jesus wird
vom Kreuz abgenommen
|
14.
Station
Jesus wird ins Grab gelegt
|
Neben der
Kirche gehört auch der Kreuzweg zu den schützenswerten Baudenkmälern.
In der vom Landesamt für Denkmalpflege herausgegebenen Liste der
Baudenkmäler in Bergkirchen 36)
wird
er mit folgenden Worten beschrieben: "Aktennummer: D-1-74-113-22;
Kreuzweg, gemauert; am westlichen Weg zur Kirche mit einreihiger Eichenallee,
2. Hälfte 19. Jahrhundert".
Der Bergkirchener Arbeitskreis Hörpfade
hat über den Kreuzweg einen Bericht von dreieinhalb Minuten Dauer
erstellt. Wenn Sie ihn hören möchten, klicken
Sie hier...
Hans Schertl
Quellen :
01) Genealogisches Taschenbuch der
deutschen gräflichen Häuser, Band 13, S. 473, 1840 (v.Roeckhel)
02) Dr.Martin v.Deutinger, Die älteren
Matrikeln des Bistums Freysing, 1849/50
03)
Stumpf,Pleikard, Geographisch-statistisch-historisches Handbuch des Königreiches
Bayern, 1852
04) Arthur v.Ramberg,Joseph Heyberger,
Topograph.-statistisches Handbuch des Königreichs Bayern, Band 5,
1867 (Statistik)
05) Bibel, Offenbarung 6,13): Und
ich sah und hörte einen Engel fliegen mitten durch den Himmel und
sagen mit großer
Stimme: Weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen,
vor den andern Stimmen der Posaune der drei Engel, die noch
posaunen sollen!
06) Josef Scheidl, Die Bevölkerungsentwicklung
des Landgerichts Dachau im Laufe früherer Jahrhunderte, 1925 (Höfe
1649)
07) Amperbote vom 31.1.1906 (Kirchturmbau), vom 22.2.1935
(Figuren Franziskus/Josef)
08) Dachauer Anzeiger vom 22.12.1949
(Glocken)
09)
Werner Widmann, von München zur Donau, 1966
10) Dr.Peter Dorner, Renaissancebild
einer Landschaft, Amperland 1968 (Apian 1568)
11)
Anton Landersdorfer, Das Bistum Freising in der bayerischen Visitation
des Jahres 1560, 1986
| |
"Filials
Lauterbach khirchpröbst. Patronus s.Jacobus.
Ist ain hofmarch, dem Georg Hundt zugeherig. Der hat auf beschehen
antzaigen weder zechpröpst noch meßner wellen erscheinen
lassen. Wirt aber durch die nachbarschafft antzaigt, das durch den
hofmarchsherrn die kirchen wol gehalten und jetzt mit gebew erweitert
werd." |
12)
Historischer
Atlas v.Bayern, Die Landgerichte Dachau u. Kranzberg Bd.I, Hefte 11/12,
Landkreis Dachau, 1952 (1818)
13) Georg Brenninger, Orgeln und Orgelbauer
im Landkreis Dachau, Amperland 1975/3
14)
Georg Brenninger: Orgeln in Altbayern. Bruckmann, München 1982, ISBN
3-7654-1859-5.
15)
Heinrich u.Margarete Schmidt, Die vergessene Bildersprache christlicher
Kunst, 1981 (Pieta 5 Wunden)
16)
Georg
Brenninger, Zur kirchlichen Kunsttätigkeit des 18.Jh im Freisinger
Raum, Amperland 1983/3
17)
Alois
Angerpointner, Orts-und Vereinschronik Lauterbach/Palsweis, 1984
18)
Wilhelm Neu, Volker Liedke, Otto Braasch,
Denkmäler in Bayern,Oberbayern, 1986 (Bauzeit Kreuzweg)
19)
Georg
Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Bayern IV, 1990
20)
Robert
Böck, Wallfahrt im Dachauer Land, Bd 7 der Kulturgeschichte des Dachauer
Landes, 1991
21)
Susanne
Fischer, Glasgemälde des späten Mittelalters, Amperland 1991/1
22)
MariaThanbichler
in der Schriftenreihe,"Die Kirchen im Pfarrverband Bergkirchen"
23)
Lydia
L.Dewiel,Oberbayern: Kunst u.Landschaft zwischen Altmühltal u.den Alpen,Dumont-Kunstreiseführer
1996 (Zwerger)
24)
Robert
Böck in Chronik der Gemeinde Petershausen, Band 2, Geschichte und Kultur,
2000
25)
Georg
Hartmann, Lauterbach, 2003 (Glocken)
26)
Dachauer Nachrichten vom 30.9.2011
(Renovierung)
27)
http://www.youtube.com/watch?v=HzRxaSQiEc8,
2014-10-30 (Glockengeläute)
28)
Dr Heisig, Kunstreferat des Ordinariats München und Freising, Kunstfahrt
2014 (Zelebr ersetz Hochaltar)
29)
Bezold/Riel, Kunstdenkmale des Königreichs
Bayern, 1895
30)
Michael Andreas Schmid, M.A, Das Werk
des Dachauer Stuckateurs Benedikt Heiß im Amperland, Amperland 2000
31)
Karl Grüner, "Unten bauchig, oben spitz", Münchner Kirchenzeitung,
v. 25.9.2005 und vom 2.10.2005
32)
Mayer-Westermayer, Statistische Beschreibung des Erzbisthums München-Freising,
1874
33)
Max Gruber, Kunsttopographie des Erzbistums München und Freising, 1982
34) Hans Kratzer, Milde Gaben, harte
Strafen, SZ vom 20.1.2021 (Opferstock)
35) Dr.Joseph
Scheidl, Über Ortnamenänderungen, Zeitschrift für Ortsnamenforschung
1, S.178-186, 1925, s.a. Amperland 1994
36)
Liste
der Baudenkmäler
-Regierungsbezirk Oberbayern Landkreis Dachau, Gemeinde Bergkirchen
37) Luisa
Fernau, Warum Rosa einst die Farbe für Jungen war, GEO-Heft-Online
vom 15. März 2024 (Rosa für Buben)
90 Bilder: Hans Schertl
(88), Hubert Eberl (2)

13.3.2022
weiter zu ...
Glockenweihe in
Lauterbach
Dachauer Anzeiger vom 22.12.1949
Am vergangenen Freitag kamen die beiden
neuen Glocken für die Filialkirche Lauterbach aus Erding an. Am letzten
Sonntag wurden, sie in feierlichem Zug zur Weihestätte gebracht.
Trotz des kalten und unfreundlichen Wetters fand sich schon frühzeitig
eine große Menge Leute im Hofe des Reindlbauern ein, wo die Glocken
untergestellt waren. Die Spitze des festlichen Zuges bildete eine Reiterabordnung.
Ihr folgte die Schuljugend unter Führung ihrer Lehrkräfte. Daran
schlossen sich die weibliche Jugend, die Feuerwehr und der Burschen- und
Veteranenverein mit ihren Fahnen an. Auf einem geschmückten Wagen
kam nun die Musikkapelle Hartmann. Den Abschluss bildete der mit Girlanden
und Schleifen gezierte vierspännige Glockenwagen, gefolgt von der
Geistlichkeit. Auf dem freien Platz vor dem Friedhof erfolgte dann die
Glockenweihe durch H. H. Pfarrer Straßmeier, assistiert von H. H.
Pfarrer Singer. Die weitere Feierlichkeit, die wegen der ungünstigen
Witterung in der Kirche fortgesetzt wurde, leitete dort der Kirchenchor
mit dem Laudate v. Ett ein. Anschließend trugen vier weißgekleidete
Mädchen vom Presbyterium aus Gedichte vor, worauf Herr Pfarrer Straßmaier
die Festpredigt hielt. Das darauf folgende Tedeum bildete den Abschluss.
Zur Christmette werden die beiden Glocken, von denen die größere
mit 10 Zentnern den Namen Christus König, die kleinere 6 Zentner
schwer, den Namen, des Kirchenpatrons St. Jakob trägt, das erste
Mal geläutet werden.
Recherchiert von Hubert
Eberl, Bergkirchen
|
![]()