|
Filialkirche
St.Vitus in GÜNDING
|

|
Kurzbeschreibung
Die Kirche St.Vitus
steht etwas erhöht am Rande des Gündinger Mooses inmitten
eines Friedhofs.
Das Gotteshaus mit dem mächtigen Turm gehört als
Filiale zur Pfarrei Mitterndorf, die seit 2011 mit weite-ren Dachauer
Pfarreien St.Jakob, Mariä Himmelfahrt und Pellheim einen Pfarrverband
bildet.
Erstmals erwähnt
wurde die Kirche in der Konradinischen
Matrikel von 1315 als "Kirche von Gundingen".
Es handelt sich
um eine Chorturmanlage, d.h.
der Altarraum ist im Erdgeschoss des Turmes unterge-bracht. Chorturmanlagen
sind in der Regel sehr alt.
Die Gündinger Kirche wurde wohl um das Jahr 1300 noch im romanischen
Stil erbaut.
|
Der Sattelturm
ist durch Blendnischen und Friese geschmückt. In ihm
hängen drei 1924 gegossene Stahlglocken.
Wie so viele Kirchen im Dachauer Land wurde auch St.Vitus
in Günding nach der wirtschaftli-chen Erholung vom 30jährigen
Krieg barockisiert (1696).
|

Verzierungen an der Tabernakeltür
|
|
Das Kirchenschiff
wurde im 19.Jh, als die Bevölkerung in Günding, ja in ganz Bayern,
sehr stark zunahm, auf 17,5 Meter verlängert. Dabei entfernte man
die barocke Ausstattung und ersetzte sie durch eine neue Einrichtung im
damals modernen Stil des Historismus (= neuromanisch, neugotisch).
In den Jahren 1977/81 (außen) und 1983/84 (innen) hat man die Kirche
renoviert.
|
Innenausstattung
Der stark eingezogene
Chor wird von einem flachen Kreuzgewölbe
überdeckt. Das Deckenfresko
aus der Zeit um 1700 stellt in einem runden Gemälde mit
Stuckumrahmung die Dreifaltigkeit dar.
Die Flachdecke des Kirchenschiffs
ist mit Ornamentikmalerei (um 1900) und -über der Orgel- mit
einem Bild des Kirchenpatrons St.Vitus sowie einer Ansicht Gündings
geschmückt.
Die Altäre sind
im neuromanischen Stil des 19.Jh. errichtet und bilden ein architektonisch
und künstlerisch beeindruckendes Gesamtbild.
Mittelpunkt des Choraltars ist der
Tabernakel (Ziborienaltar).
Die Seitenaltäre sind der
Muttergottes (links) und dem hl.Petrus (rechts) gewidmet.
Außergewöhnlich
viele Heilige stehen als Figuren in der Kirche oder sind auf
Gemälden dargestellt:
— St.Antonius
mit Jesuskind (Wandfigur)
— St.Augustinus, (auf Fenstergemälde)
— St.Barbara, (auf Fenstergemälde)
— St.Erasmus
mit Gedärmewinde (Choraltar)
— St.Johannes
Apostel mit
Kelch
— St.Johannes
Evangelist (auf Deckengemälde)
— St.Johannes d.Täufer (auf Fenstergemälde)
— St.Josef mit Palmzweig (Choraltaraufsatz)
|

per Mouseklick zu den Beschreibungen
|
| —
St.Katharina, (auf Fenstergemälde) |
|
— St.Konrad mit
Brotkorb (Seitenaltar) |
| —
St.Leonhard im Abtsornat
(linker Seitenaltar) |
|
—
St.Maria Magdalena, (auf Fenstergemälden) |
—
St.Maria mit Jesuskind
(linker Seitenaltaraufsatz),
|
|
—
St.Nikolaus im Bischofsornat
mit drei Goldkugeln (Choraltar) |
|
als Figur Maria Königin
(linker Seitenaltar), |
|
—
St.Paulus mit Schwert
und Bibel (Wandfigur) |
|
als Mater dolorosa
(Seitenwand) und |
|
—
St.Petrus mit Himmelsschlüsseln
als Relief (Seitenaltar) |
| als
Schutzmantelmadonna
(an der Empore)
|
|
als Petrus
(Seitenaltar rechts) und |
| —
St.Rupert mit Salzfass
(auf Durchgang) |
|
als
Petrus (Wandfigur) |
| —
St.Sebastian (Auszug des linken Seitenaltars) |
|
—
St.Theresia (auf Fenstergemälden). |
—
St.Urban mit Weintrauben
(auf Durchgang)
|
|
—
St.Vitus der Patron, mit Kessel
(Choraltaraufsatz), |
| — St.Wolfgang
mit Kirchenmodell (Seitenaltar) |
|
auf Deckengemälde
und Fenstergemälde)
|
| — die
Evangelisten Johannes, Markus, Lukas
und Johannes
jeweils mit Schreibfeder (Deckengemälde)
|
Pfarrverband
Günding ist seit jeher eine Filialkirche der Pfarrei Mitterndorf,
die 2011 mit den Pfarreien Mariä Himmelfahrt, Pellheim und
St.Jakob zum Pfarrverband St.Jakob zusammengefasst wurde.
2025 wurde dieser Pfarrverband mit Heilig Kreuz und St.Peter zu
einer "Stadtkirche Dachau" zusammengelegt. Dieser neue Pfarrverband umfasst
die Pfarreien St.Jakob (4.500 Mitglieder), Mariä Himmelfahrt (5.000),
Heilig Kreuz (2.800), St.Peter (2.700), Mitterndorf (1.700) und Pellheim
(800) mit insgesamt 19.000 Gläubigen. 39)
Baudenkmal
Die Kirche
gehört zu den schützenswerten Baudenkmälern. In der vom
Landesamt für Denkmalpflege herausgegebenen Liste der Baudenkmäler
in Bergkirchen 35)
wird
sie mit folgenden Worten beschrieben: "Aktennummer: D-1-74-113-12;
Sankt-Vitus-Straße 8; lisenengegliederter Saalbau mit stark eingezogenem
Chor, frühgotische Chorturmanlage um 1300, barockisiert 1696 und
Ende des 19. Jahrhunderts nach Westen verlängert; mit Ausstattung;
Friedhofsmauer, 17./18. Jahrhundert; Kriegergedächtniskapelle, Ende
19. Jahrhundert; mit Ausstattung".
Ausführliche
Beschreibung
mit ikonographischen und kunsthistorischen Hinweisen
Günding steht
auf uraltem Siedlungsland. Darauf weisen zwei Steinäxte aus der Jungsteinzeit
(4000 v.Chr.) hin, die man im Gündinger Moos gefunden hat. Die erste
schriftliche Erwähnung dürfte eine Urkunde aus dem Jahr 1140
sein, in der ein "Heinrich von Gundingen" genannt ist. Dieser
Name ist auch in den Monumentis der Klöster Weihenstephan, Schäftlarn
und Weyarn enthalten. 27)
Im Historischen Atlas von Bayern wird auch Günding erwähnt:
"1337 wurde dem Kloster Fürstenfeld das Dorfgericht über
zwei Höfe, die es von Rapot dem Eisenhofer geschenkt bekommen hatte,
durch Kaiser Ludwig d. Baiern geeignet (übereignet). Um 1440
wird ein Dorfgericht zu Günding im Besitz des Pellheimers erwähnt".
08)
Geschichte
der Kirche
Erste Kirche
Die Filialkirche St.Vitus (der Pfarrei Mitterndorf) ist eine Chorturmanlage.
Der Altarraum ist im Erdgeschoss des mächtigen Turmes untergebracht,
der an der Ostseite mit Bogenfriesen verziert ist. Chorturmanlagen sind
in der Regel sehr alt und stammen aus der Romanik. Die Gündinger
Kirche wurde wohl um das Jahr 1300 erbaut.
Hinweis: Chorturmkirchen waren vor allem in Süd- und Westdeutschland
und in Skandinavien verbreitet. In Norddeutschland, das damals konfessionell
noch nicht getrennt war, sind und waren sie unbekannt. Im Landkreis Dachau
gibt es zwölf heute noch bestehende Chorturmkirchen. Das ist im Vergleich
zu anderen Landkreisen eine hohe Zahl. Im Landkreis Erding z.B, gibt es
keine Kirche dieses Typs (mehr).
18)
Warum Chorturmkirchen
damals in dieser Form erbaut wurden, ist nicht eindeutig geklärt.
|
-
|
Nach Gottfried
Weber
24)
könnten
die "burgartig gesicherten Obergeschosse" des Turmes der
Bevölkerung "Zuflucht in Notzeiten geboten" haben.
Die oberen Stockwerke waren oft nur über einziehbare Leitern
zu erreichen. |
|
-
|
Michael Loose
25)
lehnt diese Auffassung ab, weil die Fläche in den Obergeschossen
für diese Funktion viel zu klein ist. Es sei kaum vorstellbar,
dass eine ganze Dorfgemeinschaft mit den erforderlichen Lebensmitteln
und den zur Verteidigung notwendigen Waffen (Wurfsteinen) dort Platz
gefunden hätten. Die massive Bauweise der Türme sei wegen
der Last und der Schwingungen der Glocken notwendig gewesen. |
|
-
|
Marijan Zadnikar
26)
weist
darauf hin, das die Chortürme eine Modeneuheit ihrer Zeit gewesen
seien, die große Aufmerksamkeit erregten. Sie hätten die
Leute an Burgen als Symbol der Herrschaft und der Macht erinnert.
Die Türme seien somit Zeichen des Triumphes des Christentums
über das Heidentum gewesen. |
|
-
|
Nicht vergessen
werden sollte auch, dass Kirchen als geweihte Orte ohnehin eine gewisse
Sicherheit boten. Schließlich waren auch viele der Angreifer
Christen, die eine gewaltsame Entweihung eines solchen Ortes wegen
der zu befürchtenden schlimmen Jenseitsfolgen scheuten. Dies
würde die Schutzfunktion des Turmes für die Bevölkerung
betonen. |
Freisinger Matrikel von 1315 u. 1524
01)
In der Konradinischen
Matrikel von 1315 wird die Kirche unter der Bezeichnung "Gundingen"
schon als Filiale von Mitterndorf erwähnt.
Die Sunderndorfer'sche
Matrikel von 1524 nennt zum ersten Mal das Patronat
des hl.Vitus. Die Verehrung des hl.Vitus, des Patrons des sächsischen
Königshauses, war vor 1000 Jahren vor allem im Norden Deutschlands
weit verbreitet. Als im späten Mittelalter der Kult um die 14 Nothelfer
entstand, erhielt die Verehrung von St.Vitus, der ja zu dieser erlauchten
Heiligenschar gehört, auch im Süden Deutschlands Impulse. 21)
Visitationsbericht von 1560
15)
Im Jahr 1560 hatte der Freisinger Bischof Moritz von Sandizell auf Druck
des bayerischen Herzogs Albrecht V. Albrecht V. eine Visitation, eine
umfassende Überprüfung aller Pfarrer und Pfarreien angeordnet.
Die Visitation wurde durch bischöfliche und durch herzogliche Bevollmächtigte
durchgeführt. Grund war die durch die Reformation Luthers (1517)
entstandene religiöse Unruhe, die jedenfalls in Teilen des Bistums
zur Zerrüttung des geistlichen Lebens geführt hatte. Durch die
Visitation wollte der Bischof einen detaillierten Einblick in die religiöse
Situation der Pfarreien gewinnen. Insbesondere sollte festgestellt werden,
ob die Pfarrer und die Gläubigen noch die katholische Lehre vertraten
oder der neuen Lehre anhingen. Daneben interessierte die Prüfer die
Lebensführung der Pfarrer sowie Umfang und Qualität ihrer religiösen
Kenntnisse.
Im Bericht über die Pfarrei
Mitterndorf ist auch die Filialkirche "St.Vitus in Gunding"
kurz erwähnt. Das jährliche Einkommen der Kirche (neben dem
der Pfarrei) beträgt 9 oder 10 Gulden, die in etwa mit den Ausgaben
übereinstimmen ("welche inen uber die jerlich ausgab aufgeen").
Der Pfarrer erhält für eine Wochenmesse 1 Taler jährlich.
Die Kirchenrechnung erstellt das Gericht zu Dachau kostenlos. In Giebing
gibt es kein Mesnerhaus; das Mesneramt wird wohl von einem Bauern ausgeübt.
Im Inneren der Kirche steht ein Sakramentshaus mit Ewigem Licht ("bleuchtung
allein bei der nacht"). Das Allerheiligste und die heiligen Öle
werden liturgisch
|
unrein aufbewahrt. Ein Taufstein
ist nicht vorhanden (die Taufen finden in der Pfarrkirche statt).
Der Friedhof befindet in gutem Zustand ("hat ain begrebnuß,
wirt vleissig und wol erhalten"). Die Friedhofsmauer und die
Kirche brauchen aber eine neue Bedachung. An liturgischen Gerätschaften
sind vorhanden: 2 "nit saubere" Kelche mit Corporale,
der dritte Kelch wurde vor einem Jahr anderen Zwecken zugeführt
("der dritt sey im vor aim jar empfrembt worden"). Daneben
gibt es noch: 1 Monstranz aus Messing, 2 Messbücher, 1 Liturgiebuch,
1 zerrissenes Psalmenbuch und 3 oder 4 alte Messgewänder ("hat
4 alter meßgwandt, ein guet ornät und ain zerrissnen").
Der Pfarrer wird gelobt ("Pfarrer verricht den gottsdienst
vleissig"). Der Bericht schließt mit dem Satz: "Sonst
ist kain mangel, allein wenig gemeld (=Gemälde) in der
kirchen".
|
 Auszug aus einer Landkarte
Auszug aus einer Landkarte
von Finkh aus dem Jahr 1655
Günding = Gind |
Der Pfarrer hatte eine Lebensgefährtin,
wurde aber eines ehrbaren Lebenswandel gerühmt [" Pfarrer sey aines
erbern gueten wandels"). Wenn Sie ganzen Bericht über die Pfarrei Mitterndorf
-in heutigem Deutsch- lesen möchten,
klicken Sie hier...
Nach dem 30jährigen Krieg
Ob die Kirche im 30jährigen Krieg Schaden genommen hat, ist mir nicht
bekannt. Die Zahl der Häuser in Günding ist jedenfalls von 24
im Jahr 1631 auf 17 im Jahr 1649 zurückgegangen. 30)
Zudem war das Gebiet des südlichen Landkreises Dachau
von den Kriegsereignissen besonders stark betroffen. Da dürfte die
Kirche in Giebing, jedenfalls die Kircheneinrichtung, nicht unbeschadet
geblieben sein. 1654 wurde ein neuer Seitenaltar angeschafft.
Der Kistler Veithen Klumayr erhielt
dafür 25 Gulden, der (nicht genannte) Bildhauer 12 Gulden und der
Maler Crafft den hohen Betrag von 85 Gulden. So kurz nach dem Krieg wäre
eine solche Anschaffung kaum denkbar, wenn der alte Altar nicht stark
beschädigt worden wäre.
Aus dem Jahr 1640,
mitten im Krieg, ist auch bekannt, dass die Kanzel in schlechtem
Zustand war. Denn in der Kirchenrechnung ist zu lesen, dass "Den
Khirchenbröbsten (Kirchenpflegern) auferladen ist, daß sie
mit Zueziechung Hernn Pfarrers den Predigtstuehl alßbalden und in
continenti machen lassen sollen". Oftmals hatte die Soldateska im
Schwedenkrieg Altäre und Kanzeln ganz oder teilweise als Feuerholz
verwendet.
Pferderennen am Sebastianitag
In Günding wurden in der Zeit nach dem 30jährigen Krieg
alljährlich am Fest des hl.Sebastian (20.Januar) kirchliche Pferderennen
abgehalten. Groß sind die Spuren, die sie hinterlassen haben, nicht.
Doch die kurzen Hinweise in den noch erhaltenen Resten der Kirchenrechnungen
reichen im Zusammenspiel mit entsprechenden Berichten aus anderen Pfarreien
aus, um uns ein Bild von den Rennen machen zu können. Die Texte in
den Rechnungen lauten:
|
1650:
|
An
St.Fabian und Sebastian tag zum Rennet in Vortl geben heur -.-.-
|
|
1654:
|
An St.Fabian
und Sebastian Tag zum Rennet heur umb 3 1/4 Parchet .1f:6kr: Lebzelten
und annderes in Vortl geben also zusammen 1.42.-" |
Es geht hier um Pferderennen, die in der Winterszeit an bestimmten Festtagen
abgehalten wurden. In unserer Gegend sind das St.Leonhard (6.11.), Tag der
Unschuldigen Kinder (28.12.), Silvester (31.12.) oder -wie hier in Günding-
am Festtag des hl.Sebastian (20.1.). Diese Rennen waren keine originär
kirchliche Veranstaltungen, sondern wurden nur anlässlich der Festtage
veranstaltet. Aber die Tatsache, dass die Einnahmen und Ausgaben in den
Kirchenrechnungen auftauchen, legt doch eine Verbindung mit dem kirchlichen
Bereich nahe. Solche Rennen wurden nur bei wenigen Kirchen abgehalten; belegt
sind im Dachauer Land: Kleinberghofen, Amperpettenbach, Pasenbach, Steinkirchen,
Schwabhausen, Lauterbach, Oberhandenzhofen, Glonnbercha, Dachau und Indersdorf.
Sie wurden nach einem einheitlichen Muster durchgeführt:
Die Reiter hatten als eine Art Teilnahmegebühr Getreide zu spenden,
das sie vor den Altar schütteten; dafür wurden Ross und Reiter
gesegnet. Das Getreide verkaufte die Kirche und nahm dadurch Geld ein. Die
Teilnehmer jagten auf ihren Rössern über eine Wiese und umrundeten
einen in die Erde gesteckten Stab. Als Rennmeister fungierte der Ortsgeistliche.
Der Sieger des Rennens erhielt ein großes rotes Tuch (s.o. 1654: "rott
Tuech") als Siegerpreis, das damals neben dem ideellen auch einen hohen
wirtschaftlichen Wert hatte; der rote Farbstoff war teuer. Die Nächstplatzieren
dürften weitere Tücher, Lebzelten und sogar kleine Schweine (sog.Rennsäue)
oder Gänse als weitere Preise erhalten haben.
Barockisierung 1696
Wie so viele Kirchen im Dachauer Land wurde auch St.Vitus in Günding
nach der wirtschaftlichen Erholung vom 30jährigen Krieg barockisiert
(1696). Die Kosten dafür betrugen 661 Gulden. Diesen Betrag erfahren
wir aus den Kirchenrechnungen der Pfarrei Bergkirchen. Denn Günding
erhielt zu den Baukosten ein zinsloses Darlehen des Landgerichts Dachau.
Dazu mussten alle übrigen Pfarreien beitragen. 20)
Schmidt'sche Matrikel 1738/40
01)
Der Kanonikus Schmidt
aus Freising erstellte 1738/40 eine Auflistung aller Kirchen der Diözese
Freising (Schmidt'sche
Matrikel ). Über die Kirche St.Vitus in "Gündting"
schrieb er, sie habe drei Altäre: der Choraltar sei St.Vitus geweiht;
in ihm werde das Allerheiligste aufbewahrt. Die Seitenaltäre hätten
den hl.Sebastian und den Evangelisten Johannes zum Patron. Im Friedhof
stehe ein Beinhaus und im Turm hingen zwei geweihte Glocken. Die Beschreibung
endet mit dem einzigen Satz in deutscher Sprache: "Das völlige
Vermögen des Gottshauses solle der Zeit gegen 1000 Gulden betreffen".
Damit besaß Günding mehr Geld als die Pfarrkirche in Mitterndorf
(700 Gulden).
Anbau im 19.Jh
Das Kirchenschiff wurde im 19.Jh, als die Bevölkerung in Bayern sehr
stark zunahm, auf 17,5 Meter verlängert. Dabei entfernte man die
barocke Ausstattung und ersetzte sie durch eine neue Einrichtung im damals
modernen Stil des Historismus (= neuromanisch, neugotisch).
Beschreibung 1874 04)
In der Statistischen Beschreibung des Erzbistums München und Freising
vom Beneficiaten an der Domkirche, Anton Mayer, aus dem Jahr 1874 wird
auch die St.Vituskirche in Günding als Filialkirche von Mitterndorf
beschrieben. Damals wohnten in Günding 299 Gläubige in 43 Häusern.
Zur Kirche bemerkt Anton Mayer: "Erbauungsjahr unbekannt. Stil des
vorigen Jahrhunderts. Einschiffig mit Plafond (=Flachdecke). Geräumigkeit
genügend. Baupflicht: an der Kirche der Kirchenfond, am Cemeterium
(=Friedhof) die Gemeinde. Sattel-Thurm mit 2 Glocken. 3 Altäre.
Orgel mit 4 Registern. Gottesdienste: Jeden 3.Sonntag, abwechselnd mit
der Pfarrkirche, dann am Patrocinium, Oster- und Pfingst-Montag u. am
Feste Joh.d.Täufer. Stiftungen: 1 Jahrtag und 8 Jahrmessen und 4
Quatembermessen (Quatembertage sind Mi, Frei, Sa nach: 1.Fastensonntag,
Pfingsten, 3.Septembersonntag und 3.Adventssonntag) . Meßner:
der Meßnergütler. Der Cantordienst wird derzeit von Mitterndorf
aus versehen. Kirchenvermögen 1870 rd. 5300 Gulden.
Beschreibung 1895 05)
Die Kirche
von Günding ist auch im Verzeichnis der Kunstdenkmale des Königreichs
Bayern erwähnt, dessen Dachauer Teil 1888 von Prof. Gustav von Bezold
und Dr. Georg Hager bearbeitet und 1895 von Betzold und Dr. Riehl im Auftrag
des Königl.Bayer. Innenministeriums herausgegeben wurde:
| |
"Kirche.
- An der Thüre links und rechts vom Choraltar: St. Rupertus als
Bischof, in der Linken ein Buch, worauf ein Salzkübel und
St. Urban mit der Traube auf einem Buch. Bemalte Holzreliefs
vom Anfang des 16. Jahrhunderts. H. 84 cm.
- Den Stil dieser Zeit zeigen am Choraltar selbst die Holzreliefs:
St. Nikolaus und Erasmus.
- Treffliche Arbeiten der Münchener Schule vom Ende des 15. Jahrhunderts
sind die beiden bemalten Holzstatuen des
südlichen Seitenaltars: Johannes Evangelista und
St. Petrus. Ein gewisser grosser Zug im Faltenwurf erinnert an die
Blutenburger Skulpturen. H. 80 cm.
- Der gleichen Zeit gehören St. Wolfgang mit Kirchenmodell (H.
90 cm) und St. Leonhard mit Buch, Kette und Abtsstab
(H. 82 cm) auf dem nördlichen Seitenaltar an, sowie
ein hl. Papst mit Buch (H. 105 cm) an der Südwand des Schiffes,
alle drei gute bemalte Holzfiguren.
- Im Vorzeichen an der Westseite bemalte Holzfigur der Maria, mit
dem Kind auf dem r. Arm, das Scepter in der L. haltend;
gut. 17. Jahrhundert. H. 93 cm." |
Kircheneinbruch 1972 28)
Am 30.6.1962 brachen Diebe in die Kirche ein und stahlen fünf
Heiligenfiguren, die auf den Seitenaltären standen. Nur eine Marien-Statue
ließen die Einbrecher zurück. Es handelte sich um Figuren der
Heiligen Leonhard, Johannes, Wolfgang und Petrus und von Bruder Konrad.
Während die Figur des Bruder Konrad aus neuerer Zeit stammte, waren
die anderen vier Holzplastiken, zwischen 85 und 93 Zentimeter hoch, sehr
wertvoll. "Es sind Werke eines unbekannten Meisters der Münchner
Schule, Ende 15. Jahrhundert. Die gotischen Figuren sind stilrein", erklärte
der damalige Kreisheimatpfleger Alois Angerpointner.
Die Figuren wurden nicht mehr aufgefunden. Um 1979 gab man bei einem Bildhauer
aus der berühmten südtiroler Künstlerfamilie Demetz exakte
Nachbildungen der gestohlenen Figuren in Auftrag. Sie kosteten 2.200 DM
je Figur. Diese Nachbildungen stehen heute noch auf den Altären.
siehe auch Zeitungsbericht...
Renovierungen
In den Jahren
- 1934 (Außenrenovierung 32)
),
- 1977/81 (außen + Kirchturm)
- 1983/84 (innen)
- 2023 (Dachstuhl)
| |
"Leider
können in der nächsten Zeit in St.Vitus keine Gottesdienste
stattfinden, hieß es in einer Stellungnahme der Pfarrei. Grund
der Sperrung war ein morscher Holzbalken im Dachstuhl. Er fingt den
Druck des Dachstuhls nicht mehr ab, sondern gab ihn an das Mauerwerk
des Chorbogens unter ihm weiter. Dieser Chorbogen (am Übergang
vom Kirchenschiff zum Altarraum) begann deshalb schon zu bröseln.
Die Frage, warum der Balken morsch wurde, ist noch nicht gelöst.
Am Alter allein kann es nicht liegen; wahrscheinlich stammt er aus
dem 20.Jh. Finanziell betrachtet lag der Schaden im fünfstelligen
Bereich. 36)
|
Bittgänge/Wallfahrten
Aus den wenigen noch vorhandenen Kirchenrechnungs-Unterlagen geht hervor,
dass die Gündinger alljährlich eine Wallfahrt nach Andechs unternahmen.
Der Vorsänger und der Fahnenträger erhielten dafür ein
kleines Zehrgeld, der Herr Pfarrer eine "Zöhrung", eine
Brotzeit.
Ziel der Wallfahrt nach Andechs war der "Heilthumschatz". Unter
diesem Begriff wurden viele verschiedene Reliquien zusammengefasst. 16)
Es handelte
sich dabei um die Herren-Reliquien, die die Grafen von Andechs (darunter
auch der hl.Rasso) von den Kreuzzügen und Wallfahrten aus dem Heiligen
Land mitgebracht hatten:
| |
Kreuzpartikeln,
|
ein Stück
vom Tischtuch des Letzten Abendmahles |
| |
Kopfreliquiar
der hl.Hedwig |
weitere Erinnerungsstücke
an das Leben und Leiden Christi |
| |
Stück aus
dem Gewand des hl.Nikolaus |
Blut- bzw. Gregoriushostien
(Dreihostienmonstranz) |
| |
Siegeskreuz Karls
des Großen |
das Brautkleid
und Brustkreuz der hl.Elisabeth |
| |
Teile der Dornenkrone
Christi |
|
Die Reliquien waren in einzelne Monstranzen
aufbewahrt, die den Pilgern vom Fenster der heutigen Hedwigskapelle aus
einzeln gezeigt wurden (Weisung der Heilthümer). Dazu wurden unterschiedliche
Gebete und Litaneien gesprochen und Lieder gesungen, je nachdem, ob es sich
um das Reliquiar eines Heiligen oder um eine Herrenreliquie handelte.
Aber auch Inchenhofen
war Ziel von Wallfahrern aus Günding; zumindest von einzelnen
Personen aus dem Ort. So ist im Mirakelbuch der St.Leonhardswallfahrt
der Jahre 1599-1605 34)
folgender
Eintrag über Anna Weigling vermerkt, die schwer krank war. Sie
hatte schon dreimal die Letzte Ölung erhalten. Da gelobte ihr
Ehemann mit einem Vierling Wachs nach Inchenhofen zu St.Leonhard zu
wallfahrten. Daraufhin wurde die Frau gesund.
Der Originaltext lautet:
| |
"Anna
Weigling von Günding inn Dachawer Pfarr. Die ist inn ein
schwere Kranckheit gefallen, dass man jhr drey mal das Liecht
gebrennt (= wohl Letzte Ölung).
Inn solcher Schwachheit verlobt sie jhr Haußwirth (=
ihr Ehemann) alher mit einem Vierling Wax. Hat darauff durch
Fürbitt S.Leonhards Gesundheit erlanget". |
Mehr über weitere bevorzugte
Wallfahrtsorte der Gläubigen aus dem Dachauer Land finden
Sie hier...
|

Titelbild
des Mirakelbuchs v. Inchenhofen |
Statistik
In den alten Matrikeln,
Beschreibungen und Zeitungsberichten werden immer wieder Zahlen genannt,
die sich auf die Bevölkerung, die Seelen (Pfarreiangehörige),
Häuser, Anwesen, Gebäude oder Familien beziehen. Leider ist die
Bezugsgröße dieser Zahlen sehr unterschiedlich; sie sind deshalb
nicht immer vergleichbar. So beziehen sich die Werte teils auf die Ortschaft
oder die Gemeinde, teils auf die Pfarrei bzw. den Filialkirchenbezirk.
1852: Gemeinde Günding mit 58 Familien und 296 Einwohnern
02)
1867: Gemeinde mit 301 Einwohnern, 79 Gebäuden
Ortschaft mit 190
Seelen in 44 Gebäuden (dazu Mitterndorf 71/16, Kienaden 11/3, Oberndorf
5/2, Udlding 15/3) 03)
1874: Filialkirche mit 299 Gläubigen in 43 Häusern.
06)
Zeitungsberichte
aus dem Pfarrleben
Die Dachauer Zeitungen berichteten in den letzten 120 Jahren immer wieder
auch aus dem Pfarrleben der Orte. Diese Berichte befassen sich nicht unmittelbar
mit den Kirchengebäuden, vermitteln aber einen ergänzenden Eindruck
aus der damaligen Zeit. Dabei handelt es sich um Berichte von Glockenweihen,
Kirchenverwaltungswahlen, Renovierungen usw.
Wenn Sie die Berichte über Günding lesen möchten, klicken
sie hier...
Baubeschreibung
Die Kirche steht -baumumstanden- etwas
erhöht am Rande des Gündinger Mooses mit weitem Blick bis zum
Alpenrand. Sie ist von einem Friedhof umgeben.
 Schmucklose
Westseite
Schmucklose
Westseite |
Es handelt sich -wie erwähnt-
um eine Chorturmanlage, d.h., der Altarraum ist im Erdgeschoss
des Turmes untergebracht. Seine Grundfläche von 3,5 x 4,5 Metern
entspricht den Ausmaßen des Turmes.
Das vierachsige Langhaus
(Maße:17 x 9 Meter) ist durch schwach vorgelegte Pilaster
gegliedert und besitzt rundbogige Fenster.
Die Westseite der Kirche beeindruckt
durch ihre einfache Linienführung und die konsequente Schmucklosigkeit
(siehe Bild links).
Der massige Sattelturm
gliedert sich in vier Geschosse. Er ist durch Blendnischen, Rundbogen-
und Spitzbogenfriese
geschmückt.
Im Turm hing früher eine sehr alte Glocke (gegossen
von Ulrich von Rosen, 1485). Sie wurde im Jahr 1897 um 170 Mark
an das Bayer. Nationalmuseum verkauft.
14)
|
Heutige Glockenausstattung
Derzeit befinden sich in der Glockenstube drei 1924 in Bochum von
Verein BVG gegossene Stahlglocken mit einem Gewicht von 12, 16 und 18
Zentnern und der Intonation fis, cis und a. Sie sollen aber nach Auffassung
von Glockenexperten mehr nach es', ges', as' klingen . "Zwar wäre
das erste eine für Untermollsextglocken der 1920er Jahre typische
und weit verbreitete Disposition, aber hier hört man schon ziemlich
deutlich ein TeDeum". 29)
|
Die Glockenweihe fand wohl
am 10. August 1924 am Ziegeleistadelhof in Mitterndorf statt. Pfarrer
Kräß weihte unter dem Beisein hoher Vertreter der Gemeinde
und der Geistlichkeit sowie Mitgliedern vieler Vereine und der Schuljugend
drei Glocken für Mitterndorf und drei Glocken für Günding.
Über die Glockenweihe
gibt es einen Zeitungsbericht aus dem Amperboten. Wenn
Sie ihn lesen möchten, klicken
Sie hier...
|
 |
Auf Youtube können Sie das Geläute der Glocken hören
... klicken
Sie hier.
Die 3,5 x 4,5 Meter große
Sakristei ist östlich an den Chorturm angebaut.
Das Portal der Kirche liegt unter einem Vorhaus an der Westseite.
Innenausstattung
Innenmaße des Kirchenbaus:
— Länge des Kirche 17 m (davon
Kirchenschiff: 12,5 m ; Altarraum: 4,50 m)
— Breite der Kirche: Kirchenschiff: m;
Altarraum: 3,80 m
— Höhe: Kirchenschiff: m; Altarraum: 5,90 m
Altarraum
Der rechteckige, stark eingezogene
Altarraum schließt gerade;
er wird von einem flachen Kreuzgewölbe
mit abgeschlagenen Gewölberippen überdeckt. Der Stuck im
Altarraum stammt aus der Zeit des Umbaus und der Renovierung der baufälligen
mittelalterlichen Kirche 1696-98.
Das
Deckenfresko aus der
Zeit um 1700 stellt in einem runden Gemälde mit Stuckumrahmung
die Dreifaltigkeit dar.
Links Christus mit dem Kreuz, rechts Gottvater mit dem Zepter und
in der Mitte der Heilige Geist in Gestalt einer Taube im Strahlenkranz
auf der Weltkugel. |

Hl.Dreifaltigkeit
|
Hinweis:
Die Gestalt der Taube für die künstlerische Darstellung
des Heiligen Geistes gründet sich auf den Bericht der Taufe Jesu
im Neuen Testament. Danach fuhr der Heilige Geist in leiblicher Gestalt
auf Jesus hernieder wie eine Taube (Lk., 3,22). Obwohl dies nur bedeutet,
dass sich der Geist bewegte wie eine Taube, nicht aber aussah wie
ein Vogel, wählte man die Taube als Symbol für die sonst
nur schwer greifbare dritte |
| |
Person Gottes.
Das Konzil von Nicäa im Jahr 325 hat dies sogar empfohlen. Papst
Benedikt XIV verbot 1745 die Darstellung der dritten göttlichen
Person in Menschengestalt, wie sie vereinzelt immer noch vorkam (so
z.B. im Deckengemälden der Schlosskapellen in Haimhausen und
in Unterweil-bach). |
Choraltar
/ Hochaltar
Die Altäre sind im neuromanischen
Stil errichtet und bilden ein architektonisch und künstlerisch beeindruckendes
Gesamtbild.
Altarauszug
| In
dem von großartigen Bögen gehaltenen Altarauszug des Choraltars
sitzt unter einem
säulengestützten Baldachin eine
Figur des Patrons der Kirche, des
hl. Vitus. Der obligatorische Kessel steht neben ihm. Zu beiden
Seiten sind in einigem Abstand kleine Figuren der Eltern Jesu, Josef
und Maria angebracht. |
 St.Vitus
St.Vitus
|
Vitus
wurde schon als Kind von seinem heidnischen Vater wegen seines christlichen
Glaubens vor Gericht gestellt. Den Folterknechten verdorrten die Arme,
aber Vitus heilte sie. Der Vater schloss ihn mit musizieren-den und
tanzenden Mädchen ein, die ihn verführen sollten. Als
er ihn dabei durchs Schlüsselloch beo-bachtete, wurde er blind.
Kaiser Diokletian wollte ihn mit schweren Eisenplatten erdrücken,
in einem heißen |
| |
Ölkessel
sieden oder ihn den Löwen vorwerfen. Nichts gelang. Dann wurde
er mit Haken zerfleischt. St.Vitus ist Schutzpatron gegen das Bettnässen,
weil man in früheren Jahrhunderten den den Ölkessel als
großen Nachttopf deutete. |
Der Choraltar von
1885 (Entwurf von Josef Müller, Mch) nimmt die ganze Breite des
Altarraums ein. Das
Retabel, die Altarrückwand, ist mit neuromanischen Ornamenten
in Goldfarbe bemalt und füllt den Raum auch in der Höhe
voll aus.
Mittelpunkt ist aber der zweigeschossige Tabernakel,
der in der Mittelnische anstelle einer Figur oder eines Altarblatts
aufgestellt ist. Man nennt deshalb den Altar auch Ziborienaltar.
Ziborium heißt das Gefäß zur Aufbewahrung von Hostien.
|
 Tabernakel
Tabernakel
|
Auf den Tabernakeltüren
sind reliefartige Darstellungen zu sehen:
- an der unteren Türe das Lamm Gottes über einer aus
dem Felsen springenden Quelle, aus der zwei Hirsche
trinken (siehe Bild ganz oben rechts). Das Relief
versinnbildlicht den Psalm 42 "wie der Hirsch lechzt
nach frischen Wasser.."
- die obere Türe ist mit Ährenmotiven (Grundstoff für
Brot) verziert. Davor steht ein Kruzifix
|
| |
Hinweis:
Der Hirsch galt in der Antike als Gegenspieler der Schlange. So steht
im Physiologus, einem christliches Tierbuch aus dem zweiten Jahrhundert,
dass ein Hirsch Schlangen in ihrem Versteck aufstöbert, sie tötet
und anschließend frisst. Auch Hildegard von Bingen berichtet von der
Zwietracht zwischen Schlangen und Hirschen.
37)
|
Assistenzfiguren
|

St.Erasmus
|
Die Assistenzfiguren
aus dem 16.Jh, die neben dem Tabernakel in der großen Mittelnische
stehen, stellen die Bischöfe St.Erasmus (mit
dem um eine Seilwinde gewickelten Gedärm)
und St Nikolaus (im Bischofsornat
mit drei Goldkugeln) dar.
Hinweise: St. Erasmus war um 300, der Zeit der schlimmsten
Christenverfolgung, Bischof von Antiochia. 7 Jahre lang verbarg er
sich im Libanongebirge, wo ein Rabe ihm Nahrung brachte. Dann stellte
er sich. Bei seinem Martyrium zog man ihm mit einer Seilwinde die
Gedärme heraus. Diese Winde hat ihn zum Patron der Schiffer bestimmt.
Er überstand die Marter. Danach wurde er in einen Kessel mit
siedendem Öl gesteckt, dem er unbeschadet entstieg. Er lebte
noch 7 Jahre (ohne Gedärme) in Kampanien. Erasmus ist einer der
14 Nothelfer (Patron der Seefahrer und Seiler) und als solcher für
Magenkrämpfe und Unterleibsbeschwerden zuständig. Festtag:
2.Juni
|

St.Nikolaus
|
| |
Nikolaus
war um das Jahr 300 Metropolit von Myra. Während der bald darauf
einsetzenden Christenverfolgung wurde er um 310 gefangen genommen
und gefoltert. Er überlebte und nahm 325 am 1. Konzil von Nicäa
teil. Verbreitete Legenden über Nikolaus erzählen: In einer
verarmten Familie konnte er durch gezielte Geldgeschenke (Goldkugeln),
die er heimlich durchs Fenster und durch den Kamin in die darin aufgehängten
Socken warf, verhindern, dass der Vater seine drei Töchter zur
Prostitution bewegen musste (deshalb die Goldkugeln in der Hand).
|
Das Antependium
des Choraltars besteht aus Holz und ist mehrfarbig (polychrom) gefasst.
Es wird durch kleine Säulchen in zwei quadratische Felder mit Christusemblemen
gegliedert.
Figuren auf den seitlichen Durchgängen
 St.Rupert
St.Rupert
|
An den seitlichen
Türen des bis an die Außenwand reichenden Aufbaues, die
in die Sakristei hinter dem Altar führen, sind als Reliefs die
Heiligen Rupert (mit Buch
und Salzfass in der Hand) und Urban
(im Papstornat mit Tiara und Papstkreuz sowie einer blauen Weintraube
auf dem Buch)
abgebildet. Die Reliefs stammen noch aus spätgotischer Zeit.
Die drei Querbalken des Papstkreuzes symbolisieren die drei päpstlichen
Gewalten: die Priester-, Hirten- und Lehrgewalt.
Selbst im Verzeichnis der Kunstdenkmale des Königreichs Bayern
1895 werden die Reliefs erwähnt: "Bemalte
Holzreliefs vom Anfang des 16. Jahrhunderts. H. 84 cm."
|
 St.Urban
St.Urban
|
| |
Hinweise: Rupert
lebte um das Jahr 700. Er stammte wohl aus einer fränkischen
Adelsfamilie, wird
aber auch als iroschottischer Glaubensbote bezeichnet. Er missionierte
an der Donau. Herzog Theodo schenkte Rupert die Salzquelle in (Bad)
Reichenhall und die Stadt Juvavum, wo er auch Bischof wurde (deshalb
das Salzfass).
Urban wird als Schüler des Gallus genannt. Er soll im 7.
Jahrhundert bei Heilbronn am Neckar gepredigt und den Weinbau gelehrt
haben. Nach der Legende errichtete er ein Kreuz, um das sich eine
Weinrebe schlang (deshalb die Weinrebe). |
Fenster
im Altarraum
Die beiden Fenster
im Altarraum mit Antikglas in Rundverbleiung enthalten als Mittelteile
farbige Glasgemälde.
Im südlichen Fenster ist der hl.Josef dargestellt. Das Gemälde
wurde von den Mesmerbauern-Eheleuten Josef und Katharina Wechselberger
im Jahr 1940 gestiftet und von Syrius Eberle aus Dachau nach einem Entwurf
von Hermann Stockmann gefertigt.
Das nördliche Fenster enthält ein Bild der Muttergottes.
Dieses Bild wurde von der Bäuerin Anna Nottensteiner im Jahr 1934
gestiftet, aber erst 1940 eingebaut.
Zelebrationsaltar
| Unter
dem Chorbogen steht seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts
ein Zelebrationsaltar
(sog. Volksaltar) aus Holz, der stilistisch den alten Altären
angepasst ist. Er wurde aufgestellt im Zuge der Liturgiereform durch
die Beschlüsse des 2.Vatikanische Konzils und bedeutet eine Rückkehr
zu den Wurzeln der Eucharistiefeier. |
 Zelebrationsaltar
Zelebrationsaltar
|
Der Zelebrationsalter ersetzt
nun liturgisch voll den Hochaltar.
23)
zur Geschichte der Zelebrationsaltäre:
hier klicken...
|
Langhaus /Kirchenschiff
Die
Bezeichnung des Langhauses als Kirchenschiff ist darauf zurückzuführen,
dass die Kirchenväter die Gemeinschaft der Glaubenden als Schiff bezeichneten,
das die Gläubigen aus dem Sturm der Zeit und den gefährlichen Wogen des
Schicksals rettet.
Deckenmalereien
Das Langhaus ist flach gedeckt. Die Decke des Kirchenschiffs
ist mit einem Rahmenfeld zwischen schmalem Gesims
stuckiert und mit einer Ornamentmalerei
aus dem 20.Jh. (andere Quelle: 1880) geschmückt. |
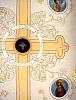 Ornamentmalerei
Ornamentmalerei
|
In
der Mitte wird ein großes Kreuz mit dreipassförmigen Kreuzbalkenenden
dargestellt, umrankt von stilisierten Akanthustrieben.
In der Mitte des Kreuzes verdeckt eine mit der Heilig-Geist-Taube
bemalte Blechscheibe das Entlüftungsloch für die Kirche.
Dort befindet sich auch ein Schriftband mit dem Text "Spiritus
Domini replevit orbem terrarum" (der Geist des Herrn erfüllt
den Erdkreis). |
| Um das Kreuz
herum sind in runden Gemälden die vier Evangelisten Matthäus,
Markus, Lukas und Johannes
jeweils mit Buch (Bibel) und Schreibfeder zu sehen. Ihre Häupter
sind von Heiligenscheinen in kräftigen Farben umgeben. Die Namen
der Evangelisten stehen am Rand der Bilder. |
  Johannes
Lukas
Johannes
Lukas
|
Die
Feder (lat.Calamus=Rohr) wurde seit dem 3. Jh. v. Chr zum Schreiben
verwendet.
Sie bestand früher aus einem abgeschrägten Schilfrohr, dessen
Spitze an der Abschrägung eingeschnitten wurde. In der gleichen
Weise präparierte man mit einem Federmesser auch die später
zum Schreiben verwendeten starken Kiele der Vogelfedern (lateinisch
penna), meist Gänsefedern. |
| Über
der Orgel ist ein Gemälde
angebracht, das den Patron der Kirche, den hl.Vitus mit Märtyrerpalme
und großem Holzkessel vor der Gündinger Kirche zeigt. |

Günding
im Gemälde
über der Orgel |
Das
Gemälde dürfte im Jahr 1950 entstanden sein.
Die Kirche wird darauf sehr wirklichkeitsgetreu abgebildet. Lediglich
das nördl. Ziffernblatt der Turmuhr fehlt. Zudem ist das Kreuz
auf dem Turmdach um 90 Grad gedreht. 19). |
Seitenaltäre
Die neugotischen Seitenaltäre
ersetzen frühere Altäre, die 1699 vom Dachauer Maler Johann
Georg Hörmann (1672-1749) gefasst
worden waren. Die vier Assistenzfiguren der Heiligen Leonhard, Wolfgang,
Petrus und Johannes sind Nachbildungen. Die Originale waren Arbeiten der
Blutenburger Schule aus dem 14.Jh. Sie wurden im Juni 1972 "nach
einer Andacht" gestohlen und sind nicht mehr aufgetaucht.
Die Nachbildungen wurden 1979 (?) vom Bildhauer Demetz aus der
berühmten südtiroler Künstlerfamilie für je 2200 DM
geschnitzt. 12).
|
Linker Seitenaltar
Der linke
Seitenaltar besitzt -wie der rechte- vier Nischen.
Oben eine breite, halbkreisförmige Nische,
darunter drei schmale Nischen, in denen in der Mitte ein Kruzifix,
außen zwei Heiligenfiguren stehen.
|
 Linker
Seitenaltar
Linker
Seitenaltar |
Die Heiligenfiguren
stellen St.Wolfgang (mit
Kirchenmodell) und St.Leonhard
(im Abtsornat mit Bibel unter dem Arm) dar.
Figuren sind Nachbildungen der 1972 gestohlenen Originale. |
Im Altarauszug eine kleine Figur
von Johannes dem Täufer.
Oberer
Altarteil
| Im oberen Halbkreis
des von Säulen getragenen Bogens ist in einem Relief die
Muttergottes mit Kind dargestellt. Anbetungsengel zu beiden
Seiten halten eine Lilie und eine Krone als Sinnbild für
die Jung-fräulichkeit und die Stellung Mariens als Königin
des Himmels. |
 oberer
Altarteil
oberer
Altarteil |
Maria ist im traditionellen
blau-roten Gewand dargestellt. Das Jesuskind steht auf ihrem linken
Knie und breitet segnend die Hände aus.
Über der Gruppe ein Schriftband mit dem Text: "Von nun an
werden mich selig preisen alle Geschlechter Luc 1.48" |

St.Wolfgang
|
Hinweise:
Wolfgang lebte im 10.Jh erst Mönch in Einsiedeln, dann ab
972 Bischof von Regensburg. Die Legende erzählt von zeitweiligem
Einsiedlerleben am nach ihm benannten Wolfgangsee. Dieses Einsiedlerleben
wurde durch den Teufel gestört, der immer wieder versuchte, Wolfgang
zu vernichten, so dass Wolfgang beschloss, sich an einem freundlicheren
Ort eine Klause zu erbauen. Er warf seine Axt ins Tal hinab und gelobte,
an dem Ort, an dem er sie wieder finden werde, eine Kirche zu erbauen
(deshalb das Kirchenmodell). Wolfgang lebte sieben Jahre in der Einöde,
danach kehrte er als Bischof nach Regensburg zurück.
|

St.Leonhard
|
| |
Leonhard
(in Bayern einer der 14 Nothelfer) lebte um das Jahr 500 als Einsiedler
und später als Abt in Frankreich. Regelmäßig besuchte
er die Gefangenen und erreichte beim König Clodwig I., dass viele
von ihnen freigelassen wurden. Deshalb galt er ursprünglich als
Schutzpatron derer, "die in Ketten liegen", also der Gefangenen -
und der Geisteskranken, die man bis ins 18. Jahrhundert ankettete.
Als die Leonhardsverehrung nach Deutschland kam, verehrte man ihn
wegen der Ketten, mit denen er in Frankreich abgebildet war, als Patron
der Haustiere, weil man diese Ketten als Viehketten missdeutete. In
Bayern erreichte die Leonhardsverehrung im 19.Jh ihren Höhepunkt.
Man nannte ihn auch den bayerischen Herrgott. Am Leonhardstag, dem
6. November, werden Leonhardiritte abgehalten und Tiersegnungen vorgenommen.
|
| Auf
dem Altartisch des linken Seitenaltars steht eine Muttergottesfigur
aus der 1. Hälfte des 17.Jh. Maria ist als Königin
des Himmels mit den königlichen Insig-nien dargestellt: Sie trägt
eine Krone auf dem Haupt und ein Zepter in der linken Hand. Mit der
Rechten hält sie das Jesuskind, das in seiner Hand den Reichsapfel
präsentiert. Der Apfel war schon im Altertum Sinnbild für
den Kosmos, später auch für die Erde, nachdem man deren
Kugelform erkannt und akzeptiert hatte. |
 Muttergottes
Muttergottes
17.Jh. |
Der
mit dem Kreuz versehene Reichsapfel in der Hand des Königs ist seit
1191 Teil der königlichen Insignien und symbolisiert den von Gott
verliehenen Herrschafts-anspruch. Gleiches gilt auch für das Jesuskind.
Hier kommt aber die weitere Bedeutung des Apfels als Paradiesapfel
und Sinnbild für den Sündenfall hinzu: Jesus weist den Betrachter
darauf hin, dass er durch seinen Tod die Erbsünde überwindet. |
Im Verzeichnis der Kunstdenkmale des Königreichs Bayern 1895 ist auch
diese Figur wie folgt erwähnt:
"Im
Vorzeichen an der Westseite bemalte Holzfigur der Maria, mit dem Kind auf
dem rechten Arm, das Scepter in der Linken haltend; gut. 17. Jahrhundert.
H. 93 cm."
Rechter
Seitenaltar
Im Altarauszug des rechten Seitenaltars
ist eine kleine Figur des hl.Sebastian zu sehen.
Im
Tympanon darunter ein Relief der hl.Petrus.
Er sitzt in weiser Abgeklärtheit auf einem gut gepolsterten Thron
mit goldener Lehne, hält ein geöffnetes Buch (Bibel) auf
seinem Knien und hebt segnend seine rechte Hand. Der Heilige ist -wie
in den meisten Petrusabbildungen seit dem 4.Jh- mit rundem Kopf und
grauem, krausen Haarkranz sowie mit Bart dargestellt. 22).
|

Oberer Altarteil
St.Petrus |
Zwei
kniende Engel zu seinen Seiten halten die Himmelsschlüssel sowie
ein Modell des Petersdoms in den Händen. Der Petersdom gilt
als Hinweis auf das Papsttum, das sich als Nachfolger von Petrus sieht.
Über den Figuren ein Schriftband mit dem Text: "Kommet zu
mir und ich will euch alle Güter ver-schaffen, Gen.45,18". |
| |
Hinweis: Die sog.Himmelsschlüssel, die der Künstler der
Petrus-Darstellung in die Hand drückte, haben den Heiligen im
Brauchtum zum Himmelspförtner gemacht. In der christlichen Symbolik
repräsentieren die Schlüssel aber die Vollmacht auf Erden
und im Himmel zu lösen und zu binden. Deshalb die beiden Schlüssel.
Nach Matthäus 16,19 sagte Jesus zu Petrus: "Dir will ich
die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du binden wirst auf
Erden, wird gebunden sein im Himmel, und was du lösen wirst auf
Erden, wird gelöst sein im Himmel". Diese Vollmacht wurde
in weiterer Folge auf den Kreis der Jünger und den Klerus übertragen.
|
 Apostel
Johannes
Apostel
Johannes |
Der Mittelteil
des rechten Seitenaltars zeigt Figuren
- des Apostels Johannes (links
mit Kelch -und übergroßer Schuhnummer) und
- des hl.Petrus (mit einem
vergoldeten und einem versilberten Himmelsschlüssel).
Die Figuren sind Nachbildungen der 1972 gestohlenen Originale von
denen Bezold/Riel (Kunstdenk-male des Königreichs Bayern) die
Auffassung vertraten, dass diese Figuren noch aus gotischer Zeit
stammen und "zum Allerbesten gehören, was in Oberbayern
aus dieser Zeit auf uns gekommen ist". Sie erinnerten "in
ihrem großzügigen Faltenwurf unmittelbar an die Art der
Blutenburger Skulpturen".
05).
|
 Apostel
Petrus
Apostel
Petrus |
| |
Hinweis: Der Apostel
Johannes, der unter dem Kreuz stand, war der Bruder des
Jakobus' des
Älteren und von Beruf Fischer. Er war erst Anhänger
Johannes' des Täufers und wurde dann Jesu "Lieblingsjünger"
(Joh.19, 26). Johannes der Apostel und Johannes der Evangelist werden
in der Überlieferung und in der Kunst häufig gleichgesetzt,
obwohl es sich um zwei verschiedene Personen handelte. |
Altartisch
Auf dem Altartisch
steht eine Figur des Bruder Konrad
von Parzham mit einem Brotkorb in der Hand.
Hinweis: Konrad von Parzham
(1818-1894) wirkte 41 Jahre lang im Kloster Altötting als Pförtner,
wo er mit Tausenden von Wallfahrern zu tun hatte, die mit vielerlei
Anliegen und Bitten zu ihm kamen. |
 Bruder
Konrad
Bruder
Konrad |
Aber auch Kinder
aus vielen armen Altöttinger Familien kamen bettelnd an die Pforte,
keines von ihnen ging leer aus.
1934 wurde Konrad von Papst Pius XI. heiliggesprochen.
Eine Zusammenstellung von Bildern und Figuren von St.Konrad in den
Kirchen des Dachauer Landes finden
Sie hier... |
Kreuzigungsgruppe
| |
An der Nordwand
ist ein großes Kruzifix
in den Stilformen des Historismus befestigt. Das ist zu erkennen
an den dreipass-förmigen Kreuzbalkenenden, an der aufrechten
Haltung des Corpus mit den waagrechte Armen und am weißen,
langen Lendentuch (Perizoma).
Darunter steht
auf einem ädikulaähnlichen Sockel die
Mater dolorosa, die schmerzhafte Mutter mit gefalteten
Händen.
Die Figur ist mit vielen Rosenkränzen behängt. Der Heiligenschein
ist -wohl wegen der zu knappen Nischenhöhe- etwas nach unten
verrutscht. Das sonst übliche Schwert in ihrer Brust fehlt.
|

Kanzelkreuz

Mater
dolorosa
|
| |
Kreuzwegbilder
Der erste Kreuzweg wurde schon
im Jahr 1756 in der Kirche eingesetzt. 38).
Das war 25 Jahre nach der päpstlichen Erlaubnis, Kreuzwegandachten
in den Kichen abzuhalten; vorher waren Kreuzwegstationen nur außerhalb
der Kirche aufgestellt. Kreuzwegandachten in den Kirchen wurden damals
mit hohen Ablässen ausgestattet. |
|

per Mouseklick zu den Beschreibungen
|
|
Die heutigen Kreuzwegbilder
im prächtigen rundbogigen Holzrahmen sind jünger.
Sie stammen aus der Mitte des 19.Jh (Öl auf Lein-wand)
und hängen über das ganze Kirchen-schiff verteilt
an den Außenwänden. Auf dem Rahmen
mit Akanthusverzierungen und der Stationsnummer sitzt ein
Kreuz.
Maße: 86 x 65 cm ohne Aufsatz.
|
 Kreuzwegbild
Kreuzwegbild
|
Die Gündinger Kreuzwegbilder
gehören zu den
Bildern, für die der bekannte Nazarener-Maler Joseph
von Führich aus Wien (1800-1876) die Vorlage geschaffen hat. Joseph von Führich
(auch "Theologe mit dem Stifte" genannt) war durch seine
Kreuzwegbilder (1844/46) inter-national bekannt geworden. Als Kupferstiche
verbreiteten sie sich über ganz Europa und unzählige Maler
(darunter auch Anton Huber für Petershausen, Franz Mayr für
Kreuzholzhausen und Anton Rick für Röhrmoos) benutzten sie
als Vorlage für ihre Kreuzwegtafeln. Aus diesem Grund gleichen
sich die Kreuzwegbilder in mind. 22 Kirchen des Dachauer Landes in
hohem Maße.
Hinweis: Kreuzwegbilder in unseren Kirchen sind erst seit 1700 üblich.
Wenn Sie mehr über den Kreuzweg und seine Darstellungen in Kirchen
des Landkreises erfahren wollen, klicken Sie hier..
|
Unter den Kreuzwegbildern
sind die Apostelleuchter
und Apostelkreuze aus Messing (19.Jh) angebracht. Auch hier weisen
die dreipassförmigen Kreuzbalken-Enden auf die Zeit des Historismus
hin.
Hinweis: Die Apostelleuchter erinnern an das in der Apokalypse
(21,14) beschriebene himmlische Jerusalem, dessen Mauern auf zwölf
Grundsteinen mit den Namen der zwölf Apostel errichtet sind.
Die Kirche sieht sich als Vorläuferin des himmlischen Jerusalems.
Üblicherweise werden die Apostelleuchter am Kirchweihfest angezündet.
|
 Apostelleuchter
Apostelleuchter
|
Kirchenbänke
Die Kirchenbänke
(25 Reihen) stammen aus dem 19. Jh. Sie besitzen Rokokowangen.
Die Muster auf den Wangen ähneln
sehr stark denen in der Kirche von Indersdorf, Schwabhausen und Niederroth
sowie - aber in geringerem Maße- denen in Sulzemoos.
|
|
Hinweis:
Kirchenstühle gab es nicht von Anfang an in den Kirchen. Die ersten
1500 Jahre standen die Gläubigen oder bewegten sich langsam im Raum.
Lediglich für Alte und Schwache gab es einige Stühle an den seitlichen
Wänden. Ohne Kirchenstühle fasst eine Kirche viel mehr Menschen; bei
dichtem Gedränge während des Gottesdienstes schien der Raum voller
Bewegung zu sein. Das feste Gestühl wurde zum Spiegel einer disziplinierten
Gemeinschaft, in der jeder seinen festgefügten Platz hat. Im 16.Jh.
wurden zuerst die evangelischen Kirchen mit Bänken ausgestattet, weil
dort die Predigt als Medium der Heilsvermittlung einen größeren Raum
einnimmt; beim Sitzen ist der Zuhörer aufmerksamer, geduldiger
und ruhiger. Die katholischen Kirchen zogen erst später nach. Die
Bestuhlung war einer der Gründe, weshalb die Kirchen zu Beginn der Barockzeit
vergrößert werden mussten. |
Vortragekreuze
| An
den Kirchenbänken stehen zwei Vortragekreuze, von denen
eines mit schwarzer Kreuzstange (um 1900) und gegossenem Corpus für
Beerdigungen, das andere mit roter Kreuzstange (18.Jh) für
Prozessionen verwendet wird. |
 Vortragekreuz
Vortragekreuz
|
Hinweis: Vortragekreuze werden beim Kirchenein- und Auszug, Prozessionen,
Wallfahrten sowie bei Beerdigun-gen vorangetragen. Dies geht zurück
auf das Jesuswort "Wer mein Jünger sein will, der verleugne
sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach". Bei
Gebetsprozessionen (Bittgängen, Kreuzweg) wird der Corpus des
Kreuzes zu den nachgehenden betenden |
| |
Menschen
gedreht, damit sie den Gekreuzigten vor Augen haben. Bei anderen Prozessionen,
z.B. an Fronleichnam und beim Ein- und Auszug zeigt der Corpus in
die Gehrichtung, d.h., er weist ihnen den Weg. Die ältesten Vortragekreuze
stammen schon aus dem 6.Jh. |
Fenster
im Kirchenschiff
|
Auch in den
Rundbogenfenstern des Kirchenschiffs sind mehrere kleinere Glasbilder
enthalten.
Eines davon zeigt den hl.
Vitus, der vor dem Kessel kniet, daneben der Gündinger
Kirchturm, über ihm die Muttergottes und im Hintergrund eine
Burg. Es ist mit "5.6.56" datiert und wurde von den Mesnerseheleuten
Vitus und Maria Wexlberger 1954 gestiftet. Rechts unten das Monogramm
des Glasmalers Syrius Eberle aus
Dachau.
|
 Fensterbilder
Fensterbilder
|
Die anderen Fenster zeigen Bilder
- der hl. Katharina (gestiftet von Jakob Sedlmayer 1954),
- des hl. Augustinus (gestiftet von August Feldl, Kunstmühlenleiter
1954),
- der hl. Barbara (gestiftet von Josef und Barbara Mayr, Schmiedemeisterseheleute,
1954),
- der hl. Cäcilia (gestiftet von Syrius und Wilhelm Eberle,
Dachau, 1954),
- der hl. Maria Magdalena (gestiftet von Johann und Magdalena Schaltermayer,1954),
- des hl. Johannes d.Täufers, (gestiftet von Johann und Magdalena
Gasteiger,1954) und
- der hl. Theresia (gestiftet von Anton und Theresia Gasteiger,1954).
Figuren
im Kirchenschiff
An der Südseite des Kirchenschiffs ist
auf einem neuromanisch gestalteten Sockel eine Figur des
hl. Petrus mit Tiara (Papstkrone) auf dem Kopf angebracht.
|
St.Petrus
mit Tiara
|
Die Tiara,
die dreifache Krone, entstand aus der phrygischen Zipfelmütze
des iranischen Hofzeremoniells des 5.Jh.v.Chr. In den ersten Jahrhunderten
des Christentums waren Papst und Klerus barhäuptig. Die Tiara
wurde erstmals im 8.Jh erwähnt. Ihre heutige Form stammt aus
dem 14.Jh. Es gibt mehrere Deutungen für die drei-fache Krone:
— Die eine besagt, sie sei das Gegenstück zu den weltlichen
drei Kronen des Kaisers (Königskrone von Aachen,
Krone der Langobarden und die Kaiserkrone von Rom).
— Eine andere Deutung weist auf das dreifache päpstliche
Amt hin: lehren, lenken und heiligen.
— Wieder eine andere bezieht die Tiara auf die drei Reiche der
Kirche: Die streitende Kirche auf Erden, die
leidende Kirche im Fegefeuer, die triumphierende
Kirche im Himmel.
— Schließlich werden die drei Kronen auch als Symbol der
Dreieinigkeit Gottes gesehen.
Früher wurde dem neugewählten Papst die Tiara mit den Worten
überreicht: "Empfange die dreifach gekrönte Tiara und
wisse, dass Du der Vater der Fürsten und Könige, der Lenker
des Erdkreises und der Vikar Jesu Christi, unseres Erlö- sers,
auf Erden bist". Seit 1964 trägt der Papst keine Tiara mehr.
Paul VI. schenkte seine Krone den amerika-nischen Katholiken als Dank
für die großherzigen Spenden zugunsten der Armen in der
Welt. |
Zwischen dem Wandkruzifix
und der Empore steht auf einem Sockel die Schnitzfigur des
hl. Paulus mit Schwert in der Hand (Anf. 16.Jh).
| |
Hinweis:
Paulus hieß eigentlich Saulus. Er war von Beruf Zeltteppichweber
und jüdischer Theologe im Laienstand. Saulus verfolgte
mit großem Eifer die junge Kirche und war bei der Steinigung
des Stephanus dabei. Vor Damaskus wurde er von einer Erscheinung
Christi getroffen, fiel zu Boden und erblindete kurzzeitig.
Missionsreisen durch den Nahen Osten und seine Briefe (7 der
13 Briefe stammen von ihm) machten Paulus bekannt. Der Schwerpunkt
der Glaubensverkündigung des Paulus ist die Gnade Gottes:
Gott schenkt seine Gnade den Menschen nicht aufgrund ihrer guten
Taten, sondern einfach, weil er ein guter, menschenfreundlicher
Gott ist. Nach eher unwahrscheinlichen Legenden starb Paulus
im Jahr 67 als Märtyrer unter Kaiser Nero durch das Schwert.
Wahrscheinlich ist er -wie im ökumenischen Heiligenlexikon zu lesen ist- eines natürlichen Todes gestorben.
|
|
 St.Paulus
St.Paulus
|
Gegenüber auf der Südseite steht eine Figur des
hl.Antonius mit dem Jesuskind.
Antonius war Franziskanermönch. Deshalb ist er hier in der braunen
Kutte der Franziskaner dargestellt. Die Farbe Braun steht traditionell für
Demut und Bescheidenheit.

St.Antonius
|
Hinweis:
Antonius lebte im 13.Jh und war ein begnadeter
Redner, der sich gegen die damaligen Häretiker
(Katharer, Albigenser und Waldenser) wandte. Seine Fastenpredigten
in Padua 1231 hatten einen sensationellen Erfolg, denn die ganze Region
schien danach wie umgewandelt: Schulden wurden erlassen, zerstrittene
Familien versöhnten sich, Diebe gaben das gestohlene Gut zurück,
unrechtmäßige und überhöhte Zinsen wurden den
Schuldnern zurückerstattet. Bis heute gilt in Italien ein damals
erlassenes Gesetz, dass niemand mit seinem Leben und seiner Freiheit
für eine Schuld haften solle, sondern nur mit seinem Eigentum.
Antonius wird als Hilfe zum Wiederauffinden verlorener Gegenstände
angerufen und gilt deshalb als "Patron der Schlamperer".
Dies geht auf zwei Legenden zurück: Als ihm ein Manuskript gestohlen
worden war, betete er so lange, bis der Dieb damit zurückkehrte.
Schöner ist die zweite Legende, nach der er einem Geizhals half
sein Herz zu suchen und es in einer Geldtruhe fand. Die Darstellung
mit dem Jesuskind auf seinem Arm ist bei uns erst seit dem 17.Jh verbreitet;
sie verweist auf eine seiner Visionen, die er beim Bibellesen hatte.
|
Empore
Die
von Wand zu Wand reichende Empore
wird von Holzsäulen zu beiden Seiten des Mittelgangs unterstützt.
Auf der Empore steht eine Orgel der Fa. Sandtner. ...
mehr dazu...
Die Brüstung ist mit acht einfachen quadratischen Flachfeldern
verziert.
|
|
Über der Empore
ist (wohl seit 1950) ein
Gemälde angebracht, das den Patron der Kirche, den hl.Vitus
mit Märtyrerpalme und großem Holzkessel vor der Gündinger
Kirche zeigt. ... mehr dazu... |
| An
der Brüstung ist eine
Schutzmantelmadonna
angebracht. Sie ist in den Stilformen der Gotik geschnitzt. Unter
ihrem Mantel lugen zehn Frauen und Männer mit mittelalterlichen
Kopfbedeckungen hervor. |
 Schutzmantelmadonna
Schutzmantelmadonna
|
Hinweis:
Der Bildtypus der Schutzmantelmadonna ist bei uns seit dem 14.Jh verbreitet.
Er wurde vor allem von den Zisterziensern und Dominikanern gefördert.
Die Darstellung geht auf den Mantelschutz im alten Rom (lateinisch
velamentum) zurück, den man Ver-folgten gewähren konnte.
Auch aus dem Mittelalter
ist bekannt, dass insbesondere vornehme Frauen
das Recht hatten, Flüchtlingen unter dem Mantel |
| |
oder
Schleier Schutz zu gewähren. Abgeleitet davon entstand die Darstellung
der Schutzmantelmadonna. In alten Schriften wird das Motiv der Schutzmantelmadonna
mit dem lateinischen Terminus auch als Mater omnium,
"Mutter aller", bezeichnet. |
Orgel
| Die
zweimanualige Orgel mit 9
(10) Registern stammt aus dem Jahr 1954 und wurde von den Gebrüdern
Sandtner aus Steinheim bei Dillingen gebaut. Sie besitzt eine
pneumatische Kegellage und einen Freipfeifenprospekt. |

Orgel
|
Die
Gebrüder Sandtner haben auch die Orgeln in den Kirchen von Unterbachern,
Oberroth, Eschenried neu gebaut oder restauriert. |
| |
Disposition
der Sandnner-Orgel von 1954: 33)
I. Hauptwerk: (C-g''') Principal
8', Gemshorn 8', Rohrflöte 4', Mixtur 2',
II. Schwellpositiv: (C-g''') Gedackt 8' Salicional
8' Principal 4' Nachthorn 2'
Pedal (C-f'): Subbaß
16', Zartbaß 16' (Windabschwächung aus dem Subbaß 16')
Koppeln: II/I,
I/P, II/P, |
Frühere Orgel
Eine frühere Orgel erwarb 1847 Pfarrer Gabler für 80 Gulden
vom Münchner Orgelbauer Frosch. Der Preis spricht für ein gebrauchtes
Instrument. Die Orgel wurde im Dezember 1847 aufgestellt. 09),10)
| |
Allgemeines
zur Orgel - Mit ihren vielen Pfeifen, die über ein Gebläse
zum Klingen gebracht werden, steht die Orgel meist im rückwärtigen
Bereich der Kirche auf der Empore. Sie hielt erst allmählich
Einzug in die Kirchen, weil sie bis in das 11. Jahrhundert als profanes
(weltliches) Instrument galt, das für das höfische Zeremoniell
verwendet wurde. Erst ab dem 13. Jh. wurde es zur Regel, in allen
bedeutenden Kirchen Orgeln zu errichten. Heute gehört eine Orgel
zur Ausstattung fast jeder Kirche. Mit ihrer Klangvielfalt und Klangfülle
trägt sie zur Verschönerung des Gottesdienstes bei. Der
Orgelprospekt, die Schauseite der Orgel, wurde früher meist durch
Künstler gestaltet. Im Barock und im Klassizismus, deren Epochen
unsere ältesten Orgeln im Landkreis Dachau angehören, wurde
der Prospekt mit reicher Ornamentik verziert. Heute setzt sich immer
mehr der Freipfeifenprospekt durch, der allein durch die harmonische
Anordnung der Pfeifen wirkt. |
Hans Schertl
Quellen
01) Dr.Martin v.Deutinger, Die älteren
Matrikeln des Bistums Freysing, 1849/50
02)
Stumpf,Pleikard, Geographisch-statistisch-historisches Handbuch des Königreiches
Bayern, 1852
03)
Arthur von Ramberg,Joseph Heyberger, Topographisch-statistisches Handbuch
des Königreichs Bayern, Band 5, 1867
04) Mayer-Westermayer, Statistische
Beschreibung des Erzbisthums München-Freising, 1874
05) Bezold/Riel, Kunstdenkmale des
Königreichs Bayern, 1895
06)
Josef Scheidl, Die Bevölkerungsentwicklung des Landgerichts Dachau
im Laufe früherer Jahrhunderte, 1925
07)
Amperbote vom 20.12.1905 (Kirchenverw.Wahl)
08) Historischer Atlas von Bayern,
Altbayern Reihe I Heft 11-12: Die Landgerichte Dachau und Kranzberg, S.46
09) Georg Brenninger, Orgeln und
Orgelbauer im Landkreis Dachau, Amperland 1975/2
10) Georg Brenninger: Orgeln in
Altbayern. Bruckmann, München 1982, ISBN 3-7654-1859-5.
11) Süddeutsche Zeitung, Beilage Landkreis Dachau,
20.4.1979 (Ortsgeschichte)
12) Dachauer Nachrichten vom 24.8.1979
(Nachbildungen der Seitenaltarfiguren)
13) Max Gruber, Werkverzeichnisse
der Dachauer Maler Johann und Johann Georg Hörmann, Amperland 1980/4
14) Max Gruber, Im Amperland tätige
Glockengießer, Amperland 1984/2
15) Anton Landersdorfer, Das Bistum
Freising in der bayerischen Visitation des Jahres 1560, 1986
16) Josef Mass, Geschichte des Erzbistums
München und Freising, 1986 (Wallfahrt Andechs)
17) Georg Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler,
Bayern IV, 1990
18) Gerhard
Hanke / Wilhelm Liebhart, Der Landkreis Dachau, S. 126, 1992 (Erding)
19) Bauer/Rupprecht, Corpus der
barocken Deckenmalerei in Deutschland, 1996
20) Robert Böck, Kirchenrechnungen
Landgericht Dachau, 1996 (Kosten Barockisierung)
21) Walter
Pötzl, Patrozinien- Zeugnisse des Kultes, Zeitschrift für bayerische
Landesgeschichte Bd. 68, 2005 (Patrozinium)
22) Sabine Remiger, Münchner
Kirchenzeitung v. 3.9.2006 (Petrus)
23) Dr Heisig, Kunstreferat des
Ordinariats München und Freising, Kunstfahrt 2014 (Zelebr ersetz
Hochaltar)
24) Gottfried Weber, Die Romanik
in Oberbayern, 1990
25) Michael Loose, Burgen Schlösser
und Befestigungen im Kreis Dachau, aus ARX 1/2019
26) Marijan Zadnikar, Die Chorturmkirchen
in Slowenien, aus Forn Vännen, 1967
27) Dr. Manfred Kudernatsch, Hubert
v.Bonhorst, 500 Jahre Pfarrkirche Mitterndorf, 1996
28) Heiligenfiguren aus Kirche in
Günding gestohlen, Dachauer Nachrichten vom 3. Juli 1972
29) Infotext Arnoldusglocke,
2021 (Glocken)
30) Josef Scheidl, Bevölkerungsentwicklung,
Zeitschrift für bayer.Landesgeschichte, S. 884
31)
Amperbote vom 12.8.1924 (Glockenweihe)
32)
Amperbote vom 07.11.1934 (Kirchenrenovierung)
33)
Organ index, freie Wiki-Orgeldatenbank, Internetseite, 2022 (Orgel)
34)
"Vilerley
gedenckwürdige Miraculn - so sich zugetragen von Anno 99 biß
ad Annum sexcentesimum quintum, bey Johann
Abbe zu Fürstenfeld, der
dessen Gottshauß Verwalter und Sorger ist", Bayerische Staatsbibliothek,
MDZ
35)
Liste
der Baudenkmäler
-Regierungsbezirk Oberbayern Landkreis Dachau, Gemeinde Bergkirchen
36)
Martin Wollenhaupt, Der Weihnachtsgottesdienst fällt aus, Dachauer
SZ vom 20.12.2023 und Dachauer Nachr.v.14.12.24
37)
https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Hirsch
38)
https://digitales-archiv.erzbistum-muenchen.de/actaproweb/document/Vz_cd23d3b7-5dc7-4ffc-afae-bbd6cd1158df
Bestand: AA001/3 Lokalia - 1409-1951
Signatur: AA001/3, PfarrA13138 (Kreuzweg 1756)
39)
Festschrift zur Gründung der Kath.Stadtkirche Dachau, 2025
43 Bilder: Dieter Reinke (3), Gottfried Doll (1), Hans Schertl
(39)

12.6.2025
|
![]()