|
ALTARRAUM
in der Klosterkirche ALTOMÜNSTER
|

Tabernakelaltar - Im Hintergrund die
Altarbilder des Herrenchors
|
Beschreibung
Der fast 60 m lange Kirchenraum
in Altomünster beeindruckt wegen der interessante Raum-perspektiven,
die sich durch die Anordnung der vier kunstvoll hintereinander gelagerten
Innenräume ergeben: Dem Vorhaus und dem großen achteckigen
Hauptraum folgt der sog. Beichtraum, der durch den darüber
liegenden Frauenchor nur 7 m hoch ist.
Daran schließt sich der Altarraum für die Pfarr-gemeinde
an, dessen Höhe wieder auf 14 m ansteigt. Dieser Altarraum
wird durch eine weiße, neubarocke Holzwand zum Herrenchor
abgeschlossen, die genau an der Stelle verläuft, an der sich
in der romanischen Kirche von 1240 die Apsis befunden hat.
| 1617 wurde
dann ein neuer Altarraum errichtet, der sich weiter nach Osten
erstreckt und den heutigen Herrenchor mit |
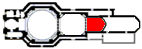 |
einschließt. Dieser Altarraum
ist gegenüber dem sog. Beichtraum um eine Stufe erhöht.
An beiden Seiten öffnen sich nördlich und südlich nochmals
zwei Emporen. |
Der Historiker Harro
Ernst schrieb 1972 in seinem Aufsatz "Zur Himmelsvorstellung im späten
Barock besonders bei Johann Michael Fischer": 17)
| |
"Gleich einem Fernrohr
leitet der niedere, dunkle Laienbrüderchor das Auge hin zum Langchor,
wo, weit mehr als mannshoch über einem Apsisrund, drei Altäre
wie Ausstellungsstücke in den Raum komponiert sind. Dies Bild
ist musealer Regie näher als dem barocken Theatrum. Indessen
ist da, in Entferntheit, Licht und Freizügigkeit, echt ein Sehnsuchtsziel." |
Tabernakelaltar
Den Abschluss des Laienchors und
damit des den Laien zugänglichen Kirchenraums bildet der halbkreisförmige
Tabernakelaltar aus dem Jahr 1893 (Künstler Josef Anton Müller).
Der Vorgängeraltar von Johann
Bapt. Straub war 1892 zerstört worden; die knienden Seitenfiguren
am alten Altar, Dominikus und Katharina, stehen im Bayerischen Nationalmuseum
München. Die frühere Madonna ist leider verschollen.
Die neubarock verzierte Holzwand erstreckt sich über die volle Raumbreite
und schließt auch die beiden Chorbogenpfeiler mit ein. Die Wand
besteht aus kostbarer weißer Täfelung mit goldenen Blumenfestons
und Gitterwerk sowie angedeutetem Gebälk.
Der Stipes, der Altartisch, besitzt eine geschnitzte Verkleidung (Antependium)
in Sarkophagform mit Reliefs in Vierpassrahmungen. Darin sind in Reliefschnitzereien
alttestamentarische Opferszenen dargestellt, die als Vorbilder für
den Opfertod Christi und die Eucharistiefeier gelten: Links das Opfer
Abrahams (Gen.22,1-19), in der Mitte das Opfer des Hohepriesters Melchisedek
(Gen.14,18) und rechts das Opfer des Abel (Gen.4,4). Durch diese
Szenen sollte der Opfercharakter der katholischen Messe betont werden,
im Gegensatz zum Mahlcharakter des evangelischen Gottesdienstes.
| |
Hinweise: Abraham wurde
von Gott auf die Probe gestellt und sollte seinen einzigen (legitimen)
Sohn Isaak opfern. Als Abraham tatsächlich den Isaak als Opfer
darbringen wollte, griff Gott ein und wies Abraham an, anstelle
des Knaben einen Widder zu opfern, der sich im Gestrüpp verfangen
hatte. Neben der Aussage, dass Gott keine (damals übliche ?)
Menschenopfer wünscht, wird die Begebenheit als Vorbild für
den Opfertod Christi (Gott opfert seinen einzigen Sohn) gesehen.
Melchisedek war zu Zeiten Abrahams Priesterkönig von
Salem (=Jerusalem). Er segnete den Abraham, als der von seinem Sieg
über Kedor-Laomer zurückkehrte und brachte im anschließenden
Dankopfer für den Sieg Brot und Wein als Opfergaben dar (Gen.
14,18-20). Wegen der Übereinstimmung der Opfergaben wurde er
im Christentum als Vorläufer von Christus angesehen. In der
christlichen Kunst soll die Darstellung des Opfers des Melchisedek
auf die lange Tradition des Messopfers mit Brot und Wein hinweisen.
Abel, der zweite Sohn Adams und Evas, besaß eine Schafherde
(Hirte), während Kain den Acker bestellte (Ackerbauer). Der
Rauch von Abels Opferfeuer, in dem ein Lamm lag, stieg senkrecht
zum Himmel auf, während das Getreideopfer seines Bruders Kain
nur qualmte und der Rauch sich auf der Erde ausbreitete. Darüber
maßlos erbost, erschlug Kain seinen Bruder. Der Gottesfürchtige
wird von seinem Neider getötet.
|
Tabernakel
Der
Tabernakel ist zweistöckig
mit vergoldeten korinthischen Säulchen.
Auf den unteren Tabernakeltüren erkennt man zwei Hirsche an einer
Wasserquelle ("Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so
lechzt meine Seele Gott nach Dir"). Die oberen Tabernakeltüren
sind mit ornamentalem Schmuck verziert |

Tabernakel
|
Auf dem Tabernakel steht als oberer Abschluss des Tabernakelaltars
eine Figur.
Sie scheint im Laufe des Kirchenjahres mehrfach ausgewechselt zu werden.
Jedenfalls habe ich bei meinen Besuchen in der Kirche verschiedene
Tabernakelfiguren gesehen. |

St.Birgitta |
 St.Alto
St.Alto
|

Weihnachtsengel
|
- Eine
Figur der hl.Birgitta
im vollen Ornat, mit den
Ordensregeln und dem Birgittenkreuz in der Hand
- eine Figur des hl.
Alto im Abtsornat mit Kelch und
Jesuskind
- die Figur eines Weihnachtsengels,
der in der Hand
das Spruchband: "Gloria" hält
- eine Marienfigur in
kostbarem Kleid mit einem flam-
menden Herz in der Hand, 12 Sternen um das Haupt und einer
Flachshaarperücke
|
  Marienfigur
mit Flachshaar
Marienfigur
mit Flachshaar
|
Auf den Voluten links und rechts
vom Tabernakel befinden sich geschnitzte Reliefs mit neutestamentlichen
Szenen,
die auf die hl.Messe hindeuten. Links die wunderbare Brotvermehrung (Mk..6,32-44),
rechts die Hochzeit von Kanaa (Joh.2,1-11). Seitlich zwei kniende Anbetungsengel.
| |
Hinweis: Tabernakel
ist das lateinische Wort für Zelt. Die seit dem 12. Jh übliche
Bezeichnung führt zurück zur Bundeslade der Israeliten zur
Zeit Mose, die ebenfalls in einem Zelt untergebracht war. Der Tabernakel
dient bereits seit frühchristlicher Zeit (unter anderem Namen)
zur Aufbewahrung verwandelter Hostien für die Sterbenden. Im
hohen Mittelalter wurde er auch Ort der Anbetung und Verehrung Christi
in der Gestalt dieses eucharistischen Brotes. Der Ort und die Form
der Aufbewahrung änderten sich im Laufe der Jahrhunderte häufig.
Das Tridentinische Konzil (1545-63) ordnete die Aufstellung des Tabernakels
auf dem Altar an. Doch diese Vorschrift wurde in Deutschland, wo man
lange daran festhielt, die heiligen Hostien in Wandschränken
und Sakramentshäuschen aufzubewahren, erst im 18. Jahrhundert
umgesetzt. Das 2. Vatikanische Konzil (1962-65) lässt dies wieder
zu. Deshalb werden in modernen oder modernisierten Kirchen Tabernakel
häufig in die Wand eingelassen oder stehen frei auf einer Säule. |
Assistenzfiguren
|
An beiden Seiten der Holzwand
stehen zwei Apostelfiguren.
Links Johannes
mit Buch und einem Kelch, aus dem sich eine Schlange windet. Der
Kelch ist üblicherweise das Attribut des Evangelisten Johannes.
Der entging einem Giftanschlag dadurch, dass das Gift wunderbarer-weise
in Gestalt einer Schlange aus dem Trinkbecher kroch. Früher
wurden der Apostel und der Evangelist Johannes als eine Person angesehen.
Rechts steht die Figur des Jakobus
d.Ä. mit vergoldeten Stiefeln, Pilgerstab, Pilgerflasche und
Muschel-pailletten auf dem Mantelkragen.
Die Figuren wurden von Johann
Bapt. Straub (1704-1784) beim Kirchenneubau um 1767 geschnitzt
39)
. Sie sind seit 1927/30
weiß 39)
, die Schuhe, Gewandsäume
und Attribute golden gefasst.
Mehr über den Apostelzyklus in Altomünster finden
Sie hier...
|
  Apostel
Apostel
Johannes u. Jakobus |
| |
Hinweise: Jakobus
der Ältere war der Sohn des Fischers Zebedäus und der
ältere Bruder des
Jüngers Johannes. Jakobus zählte zu den drei bevorzugten
Jüngern, die bei der Verklärung Jesu und in seiner Todesangst
im Garten Gethsemane zugegen waren. Der Überlieferung nach
verkündete er nach Pfingsten in der Gegend um Samaria und Jerusalem
das Evangelium, bis er durch König Herodes Agrippa I. von Judäa
im Jahr 43 geköpft wurde; Jakobus war somit der erste Märtyrer
unter der Aposteln (Ap 12,1-2). Der Legende nach setzten Anhänger
seine Leiche in ein Boot, das im Meer herumtrieb und in Galizien,
im Nordwesten Spaniens, strandete. Dort wurde er begraben. 800 Jahre
später, zur beginnenden Reconquista (Rückeroberung des
maurischen Spaniens durch die Christen) entdeckte König Alonso
II das Grab wieder und baute eine Kirche darüber. Bald begann
die Wallfahrt und Santiago de Compostela wurde eines der größten
Wallfahrtszentren des Abendlandes. Durch ganz Europa führten
feste Wallfahrtswege dorthin; bis ins 15. Jahrhundert zog der Ort
mehr Pilger an als Rom oder Jerusalem. St.Jakob erhielt seine Attribute
(Pilgerkleidung und Muschel) erst im 13.Jh. Die Pilger erhielten
am Ziel damals einen Hut, der mit einer Muschel geziert war. Zuvor
war Jakobus meist mit einer Schriftrolle abgebildet.
Pilgerflaschen (lat.curcurbita=Kürbis) waren meist birnenförmige
Gefäße, die am Rand zum Durchziehen einer Tragekordel
mit Ösen versehen sind. Ursprünglich bestanden sie aus
einem ausgehöhlten und getrockneten Flaschenkürbis, später
auch aus anderen Materialien. Da die Pilger auf ihrer Wanderschaft
zu den großen Wallfahrtsstätten der Christenheit oft
menschenleere Gebiete durchquerten, führten sie in der Pilgerflasche
immer einen Labetrunk mit sich. Vom Wallfahrtsort wurden dann meist
mit geweihtem Wasser gefüllte Pilgerflaschen nach Hause mitgebracht.
|
Früherer
Altar:
Bis
1892 standen hier auf dem Altar Figuren
einer Muttergottes, die dem hl.Dominikus einen Rosenkranz spendet
und der hl.Katharina von Siena. 113)
Gräber im Boden des
Altarraums
Vor dem Choraltar sind die Erbauer
der Kirche, die Äbtissin M. Victoria Hueber (gest. 29.1.1790),
der Prior Simon Böck sowie die spätere Äbtissin
Josepha Magg (gest.8.10.1791) bestattet. Kleine Epitaphe
aus Kalkstein (56 x 56 cm) an den Wänden weisen auf die beiden Nonnen
hin; für den Prior hat sich keine Grabtafel erhalten. Der Archäologe
Dr. Mittelstraß führt dies darauf zurück, dass der Kirchenbau
wegen seiner hohen Kosten zu großem Widerstand und zur dauerhaften
Zerrüttung im Konvent führte.
Die Gräber wurden bei den letzten Renovierungen geöffnet. Die
toten Äbtissinnen lagen mit dem Kopf im Westen in ihren Gräbern,
um bei der Auferstehung dem aus östlicher Richtung erwarteten Christus
in das Antlitz schauen zu können. Der Kopf des Priors lag dagegen
im Osten. Priester als Stellvertreter Christi stehen zu Lebzeiten im Altarraum
der Kirche (Kirchen stehen fast immer in West-Ost-Richtung), der Gemeinde
zugewandt und sollten deshalb auch im Grab in diese Richtung schauen.
Während es die in Kirchen übliche Bestattungsrichtung für
die Laien mit dem Kopf im Westen seit alters her gilt, wurde die Priesterbestattung
mit dem Kopf im Osten erst nach der Reformation eingeführt, um die
Besonderheit des geweihten katholischen Priestertums im Gegensatz zu den
nicht geweihten Pastoren der Protestanten zu betonen. Die Regelung dazu
findet sich im Rituale Romanum aus dem Jahr 1614.
Ambo
Im November 2003 erhielt die Kirche
einen neuen Ambo (Lesepult). Es
besteht aus einem rechteckigen, am oberen Ende etwas abgeschrägten
Holzblock, in den ein Kreuz eingelassen ist. "Die Verkündigung
der Lesungen und des Evangeliums sowie die Predigt erfolgen wiederum von
dem bereits in der Liturgie des ersten Jahrtausends bekannten Ambo, dem
als 'Tisch des Wortes' ein hoher Rang zukommt", heißt es
in der Liturgiekonstitution des II.Vaticanums Sacrosanctum concilium (SC
124). 15)
Deshalb wurden nach dem Konzil (um 1970) in allen Kirchen Ambos (Lesepulte)
aufgestellt.
Das
Holz stammt von einer Eiche aus Jülich, die so alt wie die Altomünsterer
Kirche war. Im Holz steckt zudem noch ein Granatsplitter aus dem 2.Weltkrieg.
Der Baum ist menschliches Werkstück und Opfer zugleich. Der Bildhauer
Klaus Simon (* 1949) hat das Eichenstück auf den Kopf gestellt.
Nach Aussagen von Pfarrer Bachbauer zeigen ihre Wurzeln nun nach oben
und holen die (geistige) Nahrung, das Wort Gottes, sinnbildlich vom
Himmel. 58)
|
 Ambo
Ambo
|
Aus dem gleichen Holz sind
auch die Sitze für Priester
und Ministranten gefertigt. "Der Priestersitz bringt nunmehr
die Aufgabe und den Dienst der Leitung zum Ausdruck und ist ein
wichtiger Orien-tierungspunkt im Gottesdienstraum" verkündete
das Konzil (SC 124).
|
 Priestersitz
Priestersitz
|
Werke des Künstlers Klaus
Simon aus Krefeld waren schon auf der Biennale in Venedig und im Lehmbruck-Museum
von Duisburg zu sehen.
Die Laienbrüder und Laienschwestern
hatten ihren Platz während des Gottesdienstes in den beiden übereinander
liegenden Oratorien auf der Nordseite (= links) des Altarraums.
Deckengemälde
im Altarraum
An der in Form
eines Tonnengewölbes gestalteten Decke sind zwei Fresken angebracht.
Im Westteil die Vision des hl. Johannes, im Ostteil die Vision
des hl. Alto.
| Das
3,70 x 3,20 m 18)
große
Fresko im Westteil zeigt die Vision
des Evangelisten Johannes auf Patmos. Johannes sitzt an einem
großen dunklen Felsen und hält eine Schreibfeder und das
aufgeschlagene Evangelienbuch in seinen Händen. |
 Vision
des Evang.Johannes
Vision
des Evang.Johannes
auf Patmos |
Zu
seinen Füßen das Attribut des Evangelisten, der Adler.
Über Johannes schwebt ein Engel und weist zum Himmel. Johannes
blickt nach oben, wo in den Wolken die (auf dem Kopf stehenden) Umfassungsmauern
des himmlische Jerusalems mit den 12 Toren erscheinen.
Die Kugel in der Mitte des Gemäldes (neben dem Engel) ist das
Heilig-Geist-Loch. |
| |
Hinweis: Die Schreibfeder (lat.Calamus=Rohr), wurde seit dem
3. Jh. v. Chr zum Schreiben verwendet. Sie bestand früher aus
einem abgeschrägten Schilfrohr, dessen Spitze an der Abschrägung
eingeschnitten wurde. In der gleichen Weise präparierte man mit
einem Federmesser auch die später zum Schreiben verwendeten starken
Kiele der Vogelfedern (lateinisch penna), meist Gänsefedern.
Erst seit 150 Jahren sind Metallfedern in Gebrauch. |
|
Im Ostteil zeigt das mit 6,40
x 3,50 Metern 18)
lang
gestreckte Gemälde die Vision
des hl. Alto.
Der Heilige steht als Priester
an einem hoch aufragenden Säulenaltar in einer Kuppelkirche.
Er hält den Kelch zur Wandlung hoch.
|

Vision
des hl.Alto am Altar |
Ein Ministrant
hebt das Messgewand und läutet mit dem Glöckchen. Über
dem Kelch erscheint das Jesuskind mit ausgebreiteten Armen. Ein
Lichtstrahl von oben, wo über einem Engel das Gottesdreieck
mit den hebräischen Buchstaben für Jahwe zu sehen ist,
fällt auf das Kelchwunder.
|
In der Wand des Chorraums befinden
sich drei kleinere monochrome (einfarbige) Darstellungen im Stuckrahmen
(Grisaillebilder) mit Bezug zu Maria. Sie gehen auf die Einführung
der Rosenkranzbruderschaft
(1644) zurück, für deren Andachten der untere Choraltar bestimmt
war.
- Auf
der Nordseite die Inschrift ELECTA - Electa ut sol (auserlesen
wie die Sonne). Maria mit dem Kind in
Wolken. Rechts von ihnen die Sonne.
- Auf der Südseite: PULCHRA
-Pulchra ut luna (schön wie der Mond). Maria mit Kind auf Wolken;
über einer
Landschaft der Mond. |
 Pulchra
Pulchra
|
- Auf der Westseite AVE. Übertragung
des Hauses von Loreto.
| |
Hinweis:
Das Heilige Haus von Loreto gilt als das Haus der Gottesmutter, in
dem sie in Nazareth gelebt hat. Dort bestand das Haus aus einer Felsgrotte
und einem vor die Grotte gebauten Haus aus Steinen. Der Legende nach
wurde das Steinhaus der Maria durch Engel auf wundersame Weise nach
Recanati in Italien eingeflogen. Und zwar in einen Lorbeerhain - daher
der Name Loreto. Tatsächlich dürfte das Haus von einer adelige
Familie namens Angeli, (italienisch: Engel), die damals über
Epirus in Griechenland herrschte, mit einem Schiff der Kreuzfahrer
über das Meer nach Loreto gebracht worden sein. Vergleiche des
Hauses mit der Grotte in Nazareth ergaben, dass Grotte und Haus exakt
zusammenpassen. |
Chorglocke
An der Südwand
hängt am Sakristeizugang die
Chorglocke (Sakristeiglocke) an einem schönen schmiedeeisernen
Gitter mit vielen Verzierungen.
Die Chorglocken werden geläutet, wenn Priester und Ministranten
am Beginn des Gottesdienstes die Sakristei verlassen und den Chor
betreten. |
 Chorglocke
Chorglocke
|
|
Sakristei
 Schloss
an der Sakristeitüre
Schloss
an der Sakristeitüre |
Die
Sakristei wurde zwischen 1723 und 1729 errichtet 39).
Sie besitzt eine Flachdecke mit umlaufender Hohlkehle;
der Boden ist mit Solnhofener Platten im Rosenspitzmuster
verlegt. Die Sakristei-türe mit ihren barocken Beschlägen
und dem ebenso alten Schloss
stammt noch aus der Erbauungszeit (1766). |
|
Neben
der Türe ist ein muschelförmiges Lavabo
(90cm) in die Wand eingelassen; es wurde um 1730 aus Rotmarmor gefertigt.
39)
Lavabos waren in einer Zeit, als es noch keine Wasserleitungen gab,
die Wasserspender (mit einem Tank hinter der Mauer). |

Lavabo
|
|
Blickpunkt in der Sakristei
ist aber die große, blau-ocker gestrichene Anrichte
mit 5 großen und 14 kleinen Türchen. Auch diese Anrichte
dürfte schon rd. 300 Jahre alt sein. Daneben steht noch eine
kleinere Anrichte in gleicher Form und gleicher Farbe mit 5 Türen.
Auf der Anrichte befinden sich
- ein Kruzifix aus dem
18.Jh,
- zwei Reliquienschreine und
- einige kleinere Heiligenfiguren auf
Sockeln.
|
 
Anrichte
und Paramentenschrank
|
Noch
älter ist der große fünftürige Paramentenschrank
(Paramente sind liturgische Gewänder). Er wurde schon im 17.Jh
erstellt 39)
b . Strukturiert ist er
durch Pilaster und dazwischen liegenden Felderungen mit Profilleisten.
Auffallend sind die aufgesetzten Kugeln.
|
Die Figuren stellen St.Leonhard,
St.Nepomuk und St.Ottilia dar. In den Sockelkästen von St.Leonhard
und St.Nepomuk sind in Klosterarbeiten Reliquien eingearbeitet. Auf den
Cedulae, den kleinen Pergamentzettelchen, stehen die Namen der Heiligen,
deren Partikel hier liegen: im Sockel von St.Leonhard die des gleichen Heiligen,
im Sockel von St.Nepomuk, die des Märtyrers S.Silvanus.
Die got.Figur der hl.Ottilia mit Äbtissinnenstab und einem Buch mit
darauf liegenden Augenpaar wurde 1929 neu gefasst. Sie stand ursprünglich
am Augustinusaltar im Hauptraum.
Die beiden Reliquienschreine
besitzen einen vergoldeten Holzrahmen mit Rocailleverzierung und
stehen auf zwei Füßen. Hinter einer Glasscheibe sieht man die
Reliquien, die in Klosterarbeiten aus Goldlahn (= mit Goldfaden umwickelter
Metalldraht), farbigen Steinen und Blattranken eingearbeitet sind.
a) rechtes Reliquiar: im Mittelpunkt Teil eines Kreuznagels. Das Cedula
ist beschrieben mit: "Serico, in quo fasiga Christi;
de ossibus S.Birgittae, de vestimento S.Birgittae;
S.Gaudentius M.; S.Epimicilii M.; S.Vitoriana M.; S.Columba Deus M.;
S.Donatus; S.Maternus Crin; S.Bonosia M.; de Lacte
V.M.; S.Urbanus M."
b) linkes Reliquiar: im Mittelpunkt Teil der hl.Lanze. Text auf dem Cedula:
"Sanct.Cruce; ,S.Desiderius M.; S.Simplici M.;
S.Desiderius M.; de loco ubi Chrus. in Templo praedicavit;
S.Juniani M.; S.Victorianus M.; S.Clementis M.; S.Gebhardo M.;
S.Modestinus M.; de ossibus S.Altonis; de monte Calvaris;
... locis, quae Christus in Terra...."
An der dem Sakristeieingang gegenüber
liegenden Wand hängt ein Bild des hl.Dismas, des "gerechten
Schächers", der mit Jesus gekreuzigt worden war. Umrahmt ist
es mit einem Schnitzrahmen, der mit Akanthusdekor verziert ist. In dem
123 x 87 cm großen Ölgemälde (auf Leinwanduntergrund)
ist der Heilige mit dem Kreuz im Arm abgebildet. Im Hintergrund sind die
drei Kreuze von Golgota zu sehen. Das Bild könnte vom Dismasaltar
stammen, der 1677 in der Kirche stand.
Hans Schertl

Quellen:
hier
klicken...

28.12.2018
|
![]()