|
Evangelische
Kirche in KEMMODEN

Jetzendorf,
Kirchstraße 1
Lage der Kirche auf der Landkarte ...
|
Kurzbeschreibung
Kemmoden ist das älteste
der Zentren der evangelisch luth. Gemeinde Kemmoden-Petershausen,
einer landkreisübergreifenden Kirchengemeinde mit rd. 3600
Christen.
Die Kirche liegt zwar schon
im Landkreis Pfaffenhofen, das Gebiet dieser Pfarrei umfasst aber
auch den gesamten Nordosten des Landkreises Dachau. Kemmoden hat
deshalb große Bedeutung für die evangelische Kirche im
Dachauer Land.
Schon ab 1799
lockerte Kurfürst Max IV. unter dem Einfluss seiner lutherischen
Gemahlin Karoline von Baden vorsichtig die strengen Religionsbeschränkungen.
1803 und 1818 wurden Religionsedikte erlassen, die evangelischen
Bürgern die Ansiedlung und die Religionsausü- bung erlaubten.
Da es in Bayern viele dünn besiedelte Gebiete, vor allem in
Moosgegenden, gab, rief Kurfürst Max IV. um 1800 Siedler ins
Land. Dieser ersten Welle folgte 20 Jahre später eine zweite,
bei der
|
sich die Siedler vor allem nach verwaisten
Bauernhöfen umsahen und so auch in unsere Gegend kamen. Viele wanderten
um 1818/20 aus dem Elsass und aus der Rheinpfalz, das von den Franzosen
besetzt war, ein. Ein Großteil von ihnen gehörten protestantischen
Kirchen an (Lutheraner, Mennoniten und Freikirchliche).
Die erste evang. lutherische Kirchengemeinde
in unserer Gegend umfasste die Gebiete der Landgerichte Dachau, Aichach,
Pfaffenhofen, Schrobenhausen, Freising und Moosburg. Die Gesamtzahl der
Protestanten in diesem großen Gebiet betrug 280. Als Sitz der Kirchengemeinde
wurde 1820 Kemmoden gewählt, weil
es zentral lag und weil dort eine größere Zahl von Evangelischen,
nämlich 30, wohnten.
Als erstes
Gotteshaus diente die Hofkapelle des Wirts, der Fam.Lang. Doch das war
nur eine Notlösung. So begann man 1822 mit der Planung einer Kirche.
Die Genehmigung dauerte lang. Erst 1828 konnte mit dem Bau begonnen werden,
der ein Jahr, bis 1829 dauert.
Die Kirche sah zunächst wie ein normales
Wohnhaus aus. 1837 wurde sie um eine Fensterachse verlängert und
erst 1876 kam der charakteristische Dachreiter hinzu, der die Kirche als
solche nach außen kenntlich macht.
Aus Kostengründen plante man das Gebäude ausschließlich
nach praktischen Gesichtspunkten:
- im Erdgeschoss befanden sich der Schulraum und eine kleine Pfarrer-
bzw. Lehrerwohnung mit 2 Kammern und einer kleinen
Küche;
- im Obergeschoss darüber der schlichte Betsaal.

Der Betsaal
ist ein 12,35 m langer, 7,65 m breiter und 3,45 m hoher, rechteckiger
Raum ohne architektonische Gliederung. Überdeckt ist er mit einer
zurückhaltend gemusterten Kassettendecke. Zehn große rundbogige
Fenster lassen nicht nur viel Licht herein, sondern geben dem Betsaal
auch sein Gepräge.
Blickpunkt ist ein Altar
in der Formensprache des Neurokokos, hinter dem ein hohes Kruzifix emporragt.
Auf dem Altar steht dekorativ ein Pult, auf dem eine geöffnete Bibel
liegt. Sie weist auf die überragende Bedeutung des Wortes Gottes
im evangelischen Gottesdienst hin: in Form des Evangeliums auf das geschriebene
Wort, in Form der auf der rechten Seite stehenden Kanzel auf das gesprochene
Wort.
Vor dem Altar ist der Ort der Taufe. Hier befindet sich auf einem Ständer
das Taufbecken; in ihm ein silberner Krug, in den das Taufwasser eingefüllt
wird.
Ausführliche
Beschreibung
mit ikonographischen und kunsthistorischen Hinweisen
Kemmoden ist das älteste der
Zentren der evangelisch luth. Gemeinde Kemmoden-Petershausen, einer landkreisübergreifenden
Kirchengemeinde mit rd. 3600 Christen. Die Kirche liegt zwar schon im
Landkreis Pfaffenhofen; das Gebiet dieser Pfarrei umfasst aber auch den
gesamten Nordosten des Landkreises Dachau. Kemmoden hat deshalb große
Bedeutung für die evangelische Kirche im Dachauer Land.
Einwanderung
Schon ab 1799 lockerte König Max I. unter dem Einfluss seiner lutherischen
Gemahlin Karoline von Baden vorsichtig die strengen Religionsbeschränkungen.
1803 und 1818 wurden Religionsedikte erlassen, die evangelischen Bürgern
die Ansiedlung und die Religionsausübung erlaubten. Und bald kamen
auch Zuwanderer. Denn in Bayern waren die Bedingungen für Neusiedler
relativ gut. Bayern hatte zu Beginn des 19.Jh. rd. 4 Mio Einwohner (heute
13 Mio). Es gab noch freie Siedlungsgebiete, auch wenn sie viel Arbeit
forderten. Zudem gab es viele leer stehende Bauernhöfe, die einen
neuen Besitzer suchten. Die Leerstände waren zum geringen Teil durch
die Säkularisation (vom Kloster selbst bewirtschaftete Höfe),
zum größeren Teil wohl durch die Koalitionskriege (1792 bis
1815) und durch die wetterbedingten Missernten (Ausbruch des Tambora 1815,
Jahr ohne Sommer 1816) verursacht.
In der linksrheinischen Rheinpfalz war durch die jahrelange französische
Besatzung ein Auswanderungsdruck entstanden. Die Einwohner hatten unter
den Massenaushebungen für das französische Heer und unter den
Kriegskosten zu leiden. Zudem trieb die Überbevölkerung die
Bodenpreise in die Höhe. Deshalb war es für Bauern verlockend,
den heimischen Hof teuer zu verkaufen und dafür woanders ein größeres
Gut zu erwerben. Die Menschen wanderten nach Nordamerika, Russland, Österreich
und eben nach Bayern aus. 04)
Die ersten vom späteren König gerufenen Siedler kamen um 1800
nach Bayern. Sie wurden in die Moorgegenden von Rosenheim und ins Donaumoos
geschickt, um das Land urbar zu machen. Die Siedler in unserer Gegend
kamen erst um 1819/20. Sie waren wohl auch nicht vom bayerischen König
gerufen worden, sondern wanderten selbstständig ein, weil sie sich
hier bessere Lebensbedin-gungen erhofften. Aus den behördlichen Unterlagen
geht hervor, dass viele Auswanderer in der Pfalz auf gut Glück losfuhren
und erst bei der Ankunft in Bayern sich nach verwaisten Höfen umsahen.
04)
In Fränking, Senkenschlag, Kemmoden, Kleinschwabhausen und Lanzenried
ließen sich rd. 120 Familien aus der Rheinpfalz und dem Elsass nieder.
Es handelte sich meist um Lutheraner (Elsass), Reformierte und Mennoniten
(Rheinpfalz); auch Katholiken (aus der bayerischen Pfalz) waren darunter
10).
Nach Kemmoden kamen vier Familien, die hier zwei Bauernhöfe erwarben
und aufteilten. 01)
Im Pfarrbuch von Kemmoden aus dem Jahr 1836 steht
dazu:
| |
"So
geschah es denn auch, daß im Jahr 1820 sich eine Familie aus
Rheinbauern, zwei reformierte oder eigentlich unirte und zwei katholische
in dem Weiler Kemmoden je zwei durch gemeinschaftlichen Ankauf häuslich
niederliessen, wodurch dann zwei Güter in vier geteilt wurden.
Es mussten darum zwei neue Wohnungen erbaut werden. Im Herbste desselben
Jahres liessen sich zwei andere Familien, eine evangelische aus Rheinbeiern
und eine mennonitische aus Rheinhessen durch gemeinschaftlichen Ankauf
eines großen Hofes, den sie in zwei Theile abtheilten, dahier
häuslich nieder. Es musste nun wieder ein Haus mehr erbaut werden.
Im Jahre 1831 kaufte sich noch eine evangelische Familie hier ein,
so daß dermalen zwei unirte, zwei evangelisch lutherische und
eine mennonitische Familie, dann zwei Rheinbairische katholische und
drei altbaierische katholische Familien zu Kemmoden sich befinden.
Dasselbe zählt ausser der Pfarr-Vicariats-Wohnung und dem Gartenhause
10 Häuser."
02) |
Zentrum Kemmoden
Die erste evang. luther. Kirchengemeinde in unserer Gegend umfasste die
Gebiete der Landgerichte Dachau, Pfaffenhofen, Schrobenhausen, Aichach,
Freising und Moosburg 10).
Die Gesamtzahl der Protestanten in diesem großen Gebiet betrug nur
280. Als Sitz der Kirchengemeinde wurde 1820 Kemmoden gewählt, weil
es zentral lag und weil dort eine größere Zahl von Evangelischen,
nämlich 30, wohnten (2017 waren es in Kemmoden nur noch 7 Kirchenmitglieder
10)).
Der idealere Mittelpunkt wäre Jetzendorf gewesen. Doch dort wohnte
kein einziger Protestant. Und in dieses rein katholische Milieu wollte
man keine evangelische Kirche setzen. Dies gebot auch die Fürsorgepflicht
für den Lehrer/Mesner und den später einmal hinzukommenden Pfarrer.
In der Pfarrchronik von 1836 heißt es dazu
02):
| |
....
so bestimmten sie Jetzendorf. Allein auch dieses lag bloß für
die im K.Landgericht Dachau Wohnenden gelegen, zu dem war dort gar
keine evangelische Familie (wie auf bis jetzt auch keine alldort ist)
und der evangelische Geistliche oder Schullehrer wäre ganz abgeschlossen
von seinen Glaubensgenossen gewesen und allein für sich unter
Katholiken, was doch auch wenigstens nicht immer rathsam erscheint." |
Vielleicht
wäre die Entscheidung anders ausgefallen, wenn damals bekannt gewesen
wäre, dass 1867 Jetzendorf eine Bahnstation an der Linie München-Ingolstadt
wurde und damit viel besser zu erreichen gewesen wäre als Kemmoden.
Ab 1820 trafen sich die Gläubigen von Kemmoden in einer (inzwischen
abgetragenen) Hofkapelle des Wirts zu ihren Sonntagsgottesdiensten. Zu Amtshandlungen
mussten sie aber nach München fahren oder warten, bis der evangelische
Pfarrer aus München ein- bis zweimal jährlich (!) vorbeikam, um
alle inzwischen anstehenden Taufen, Konfirmationen und Trauungen abzuhalten.
04)
Kirchenbau
Eine Hofkapelle für eine Pfarrei mit so großem Einzugsgebiet
und immerhin 280 Mitgliedern war nicht längere Zeit tragbar. So bemühten
sich die Siedler schon 1822 um die behördliche Erlaubnis zum Kirchen-
und Schulbau. Sie konnten auch einen Bauplatz mit 5 Tagwerk Garten, Acker
und Wiesen 02)
vorweisen, der von dem Gemeindemitglied (und Mennoniten) Dahlem
zur Verfügung gestellt wurde. Der Wirt hatte noch ein Grundstück
für den Friedhof dazu gegeben.
Doch es dauerte bis 1828, bis Pfarrer Beck aus München endlich den
Grundstein legen konnte. Der Bau dauerte nur ein Jahr, obwohl es einige
Probleme gab.
Der erste Plan sah ein kleineres, aber besser eingeteiltes Gebäude
mit einem für die Landwirtschaft geeigneten Nebengebäude vor.
Dann beschloss man aber während des Baus einen weiteren Bauplan,
der ein größeres Gebäude vorsah, aber wegen der höheren
Kosten letztendlich zu einem "in jeder Hinsicht unzweckmäßig
eingerichteten und in jeder Beziehung erbärmlich schlechten Gebäu-des"
führte. Die Mehrkosten des zweiten Bauplans sollten durch eine Materialspende
des damaligen Besitzers des säkularisierten Klosters Scheyern, Claus
Moritz Frhr. von Taube aus Sachsen, abgedeckt werden. Doch das gelieferte
Material war so schlecht, dass man es nicht verwenden konnte; zudem mussten
die Kemmodener außerordentlich hohe Transportkosten bezahlen. Taube
kostete der Pfarrei viel Geld 10).
Dazu kam, dass durch diese missliche Begebenheit der Bau erheblich verzögert
wurde. So konnte das Gotteshaus erst ein Jahr später, 1829,
fertiggestellt werden 02).
Der erste Gottesdienst wurde am 8.11.1829 gefeiert. 04)
Allerdings in einem völlig leeren Kirchenraum: Pfarrer
Friedrich Schmidt schreibt
dazu: 02)
"Allein
noch war im Betsaale nichts weiter zu sehen als die vier Wände. Als
Kanzel musste ein Fensterladen benutzt
werden. Altar, Orgel, Sitze weder für den Prediger noch für
die Zuhörer, waren noch nicht vorhanden".
Im gleichen Jahr wurde die evangelische Gemeinde offiziell gegründet.
Dies geschah mit der Wahl des ersten Kirchenvorstandes, die am 24.12.1829
vom königl. protestantischen Dekanat München bestätigt
wurde 04).
Kemmoden erhielt einen "stabilen Vicar als Expositus der protestantischen
Pfarrei München, der aber auch zugleich den Schulunterricht übernehmen
mußte" 01).
Das Gebäude hat man aus Kostengründen
nach ausschließlich praktischen Gesichtspunkten geplant:
- Im Erdgeschoss befanden sich der Schulraum und eine kleine Pfarrer-
bzw. Lehrerwohnung mit 2 Kammern und einer kleinen Küche; - im Obergeschoss
darüber der schlichte Betsaal. Solche Kirchen gibt es nur selten;
in Bayern finden wir sie noch in Lanzenried
und in Feldkirchen.
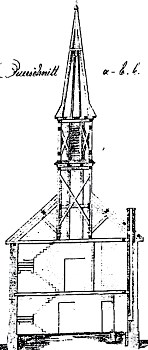 Bauplan
Dachreiter
Bauplan
Dachreiter |
Das -übrigens nie als Kirche geweihte- Gotteshaus wurde
1837 um eine Fensterachse (von vier auf fünf) nach Westen
hin verlängert. Der Altar steht in diesem Verlängerungsteil.
Zunächst glich
das Gotteshaus einem großen Wohnhaus, das man als Kirche
nur durch die rundbogigen Fenster identifizieren konnte. Die
Gemeindemitglieder und die Kirchenverwaltung wollten aber
eine Kirche haben, die auch für die "Andersgläubigen"
als solche zu erkennen ist. Deshalb beschlossen sie, dem Gebäude
einen Turm aufzusetzen. Der Wirt trug die Kosten.
1876 erstellten sie einen Plan dafür (siehe Bild links).
Bei dem Turm handelt es sich um einen Dachreiter, der nicht
bis zum Boden reicht, sondern auf den untersten Querbalken
der Dachkonstruktion gründet. Er ragt rd. 13 Meter über
den Dachfirst empor. Im unteren Teil ist er viereckig. Dort
ist die Kirchturmuhr angebracht. Darüber ist er achteckig,
mit einem Spitzdach versehen und oben mit einem Kreuz gekrönt.
Der Wirt stiftete nicht nur den Dachreiter, sondern auch die
beiden Glöckchen aus seiner Privatkapelle (die Lang von
einem kath.Besitzer aus Habertshausen zurückkaufen musste).
Die Glocken wurden vom Treppenhaus aus per Seil geläutet.
Dies ist noch heute so.
|
|
|
Geschichte
der Glocken 08)
|
1877
|
Zwei
größere Glocken kamen 1877 dazu: Die Fa. Eduard Becker
in Ingolstadt goss eine Glocke mit 201 kg und eine
mit 106 kg. Die Kosten betrugen 1.141,55 Mark. |
|
1918
|
Die
beiden 1877 gegossenen Glocken mussten zum Einschmelzen für Kriegszwecke
abgeliefert werden. |
|
1922
|
Anschaffung
von zwei Glocken durch die Fa. W.Vielwerth in Ingolstadt, eine davon
290 kg schwer. Kosten: 14.968 Mark |
|
|
Spende
einer dritten Glocke durch Herrn Müller aus Bernhausen. Diese
Glocke ist noch vorhanden. |
|
1941
|
Ablieferung
der kleineren Glocke bei der "Reichsstelle für Metalle"
für Kriegszwecke am 17.12. |
|
1942
|
Ablieferung
der großen Glocke am 15.1. (Im Turm blieb nur die 1922 gestiftete
Glocke) |
|
1949
|
Zwei
neue Glocken von der Fa. Czudnochowsky aus Erding; Einweihung an Ostern
|
|
2002
|
Überholung
der Glockenanlage im Zuge der Elektrifizierung der Turmuhr |
| 2021 |
Neue
Fenster für rd. 25.000 Euro; einige Bogenfenster stammten noch
aus der Erbauungszeit um 1829. 11)
|
Protestanten - Katholiken
Das Zusammenleben zwischen den eingesessenen Katholiken und
den zugezogenen Protestanten gestaltete sich schwierig. In seinen Lebenserinnerungen
schreibt der erste protestantische Prediger Ludwig Friedrich Schmidt über
seine erste Zeit in Bayern:
| |
"In München
waren Protestanten zur Zeit meiner Ankunft eine ganz neue Erscheinung.
Die meisten Einwohner hatten in ihrem Leben keinen gesehen und glaubten,
sie müßten anders aussehen, als andere Leute. Darum war
die Furcht vor diesen gefährlichen Ketzern und ihr bigotter Intolerantismus
wohl begreiflich". 02) |
Innerevangelische
Ökumene
Die Neusiedler gehörten nicht nur der lutherischen Kirche an;
auch Reformierte und Mennoniten waren unter ihnen. Grundsätzlich
arbeiteten sie gut zusammen und vermieden es, die Unterschiede besonders
zu betonen. Dennoch mussten einige Differenzen geklärt werden. Zum
Beispiel die Frage nach der "richtigen Gottesdienstform" und der richtigen
Auslegung der Bibel. Ein besonderes Problem war die Bekenntniszugehörigkeit
der Kinder bei Eheleuten verschiedener evangelischer Glaubensrichtungen
(Ehen mit Katholischen wurden praktisch nie geschlossen, die Siedler heirateten
nur untereinander).
Man einigte sich ab 1835 schließlich darauf, dass die Töchter
dem Glauben der Mutter, die Söhne aber dem väterlichen Bekenntnis
folgten. Beim Reichen des Abendmahls ging es streng abwechselnd zu; Lutheraner
erhielten Hostien, Reformierte Brot. Es dauerte lange Zeit, bis sich in
Kemmoden und Lanzenried der lutherische Ritus voll durchsetzte. Die Mennoniten
haben seit 1841 ihr Zentrum mit einem eigenen Bethaus in Eichstock.
04)
Die Kirche
steht inzwischen unter Denkmalschutz.
Friedhof
1828 stiftete die Wirtsfamilie Lang ein Grundstück für den Friedhof,
der bei der Grundsteinlegung für die Kirche von Pfarrer Beck aus
München eingeweiht wurde.
Im Münchner Raum gibt es nur zwei rein evangelische Friedhöfe:
in Kemmoden und in Lanzenried.
In Allershausen, einem weiteren Siedlungsschwerpunkt der evangelischen
Christen, wird der Friedhof schon seit 180 Jahren von beiden Konfessionen
genutzt. Aber es gab dort früher eine katholische und eine protestantische
Schaufel. 10)
Pfarrer
In den ersten Jahren nach der Ansiedlung hatte Kemmoden keinen eigenen
Pfarrer. Allenfalls ein- bis zweimal im Jahr kam aus München ein
Vikar, um die seit dem letzten Besuch geborenen Kinder zu taufen und das
Abendmahl zu spenden. Die ersten hier ansässigen Vikare mussten
zugleich als Lehrer und Gemeindeschreiber tätig sein, um ihre Familie
ernähren zu können (erst 1852 kam ein Hilfslehrer dazu). Hanke/Liebhart
(siehe Quellen) beschreiben in diesem Zusammenhang die kuriose Situation,
dass ein katholisches Brautpaar zunächst beim evangelischen Vikar
in dessen Eigenschaft als Standesbeamter erscheinen musste um sich dann
beim katholischen Amtsbruder kirchlich trauen zu lassen.
Eine Pfarrerliste finden Sie hier...
Gottesdienste
Nach den Annalen der protestantischen Kirche aus der Zeit um 1840 wurde
in den ersten Jahrzehnten
"an
jedem Sonntage ein Predigtgottesdienst gehalten, auf den dann die Christenlehre
folgte, da die weite Entfernung vieler
Kirchengenossen ihr nochmaliges Erscheinen in
einer späteren Stunde nicht zuließ. Diese Einrichtung gewährt
auch den Vortheil,
daß die ganze Gemeinde bei der Katechisation
anwesend bleibt, was zur Verbreitung und Befestigung besserer
Religionskenntnisse wesentlich beitragen kann".
01)
Heute finden Gottesdienste
- alle zwei Wochen in Kemmoden und Lanzenried und
- jede Woche in Petershausen und Indersdorf statt.
Schule
In die Schule im Erdgeschoss
der Kirche gingen ab 1828 zunächst Kinder aus weiter Entfernung.
In den Schulakten von 1836 sind 37 Werktags- und 34 Feiertagsschüler
aufgeführt. Da waren die Schulen in Tafern (1833) und in Lanzenried
(1836) schon eröffnet. Die neuen Schulen ersparte den Kindern
rechts der Ilm einen Schulweg von zweimal 1 1/2 Stunden.
04)
1880 baute man in Kemmoden neben die Kirche ein Schulhaus und nutzte
den Raum im Erdgeschoss der Kirche anderweitig. Die Schule bestand
bis 1937. Dann verboten die Nazis Bekenntnisschulen.
|
 |
Innenausstattung
Mit der Möblierung
tat sich die arme Gemeinde schwer: Erst ein halbes Jahr nach der Einweihung
konnte der Kirchenraum mit Bänken und der Schulraum mit Tischen und
Tafeln eingerichtet werden. Ein alter Fensterladen diente während
der ersten Zeit als Kanzel. 1833 kam eine Orgel und erst 1888 der Taufstein
hinzu.
 |
Der
Betsaal ist ein 12,35 m langer, 7,65 m breiter und 3,45 m hoher,
rechteckiger Raum ohne architektonische Gliederung. Überdeckt
ist er mit einer zurückhaltend gemusterten Kassetten-decke.
Zehn große rundbogige
Fenster lassen nicht nur viel Licht in den Raum, sondern geben dem
Betsaal auch sein optisches Gepräge. Die ersten acht Jahre
hatte der Raum nur acht Fenster, dann kam durch die Erweiterung
des Gebäudes ein Fensterpaar hinzu. Der Anbau macht sich durch
einen sich immer wieder bildenden Riss im Putz bemerkbar. 10)
Die
Lampen sind an der Wand zwischen den Fenstern angebracht.
|
Neben
der Eingangstüre steht eine kleine Orgel im dekorativen Gehäuse,
das farblich an die Einrichtung angepasst ist. Der Spieltisch
ist seitlich vor dem Gehäuse platziert. Er enthält ein Manual
und ein Pedal mit sechs Registern.
Disposition: Manual: Gedackt 8', Salicional 8', Principal 4', Oktav
2, Mixtur 2fach
Pedal:
Subbass 16', Pedalkoppel
Die Orgel wurde 1833 "von einigen sehr achtungswerthen Personen
aus Nürnberg" gestiftet. 01)
Sie stand früher vorne, links vom Altar und erhielt ihren heutigen
Platz ganz hinten erst später. |
 Spieltisch
Spieltisch
|
Kirchenbänke
Die ins. 17 Kirchenbänke,
die im Frühjahr 1830 in die Kirche kamen, sind in blau lackiert.
Dadurch gewinnt auch der Raum an "Farbe". Die Wangen sind aus
glatten Brettern ausgeschnitten. Ihr Relief erinnert an barocke Formen.
Die Wangen sind 98 cm hoch; sie haben damit die alten protestantischen
Maße. Denn nach einem Lehrbuch für Möbelschreiner aus
dem Jahr 1892 beträgt/betrug die Höhe von Bänken für
protestantische Kirchen knapp einen Meter, während sie in römisch-katholischen
Kirchen bei nur 80 bis 90 cm liegt/lag.
Bis weit ins 20.Jahrhundert hinein gab es vor den heutigen Bänken
zu beiden Seiten des Altars noch weitere Sitzgelegenheiten für den
Kirchenvorstand. Sie waren vom Volk durch eine Verglasung mit Butzenscheiben
getrennt.
Altar
Blickpunkt
des Betsaales ist der Altar
im Westteil des Raumes im Stil des Neurokoko, hinter dem ein hohes
Kruzifix im gleichen
Kunststil emporragt.
Auf dem Altar steht dekorativ ein Pult, auf dem -flankiert von zwei
Kerzen auf gedrechselten Holzleuchtern- eine geöffnete Bibel
liegt. Sie weist auf die überragende Bedeutung des Wortes Gottes
im evangelischen Gottesdienst hin:
Das geschriebene Wort wird durch das Evangelien-buch, das gesprochene
Wort durch die auf der rechten Seite stehenden Kanzel
(Ambo) symboli-siert.
Diese Kanzel kam ein halbes Jahr nach der Einweihung in die Kirche.
Vorher befand sich an ihrer Stelle ein alter Fensterladen.
|
 Altar
Altar
|
An
der Vorderfront des Altars ist ein Tuch mit dem eingestickten Bild
einer Weinrebe
angebracht. Es ist das Gegenstück zum Tuch an der Kanzel, das
neben dem Christuszeichen "PX" Weizenähren zeigt.
Vor dem Altar ist der Ort der Taufe, des zweiten Sakraments. Hier
befindet sich seit 1888 auf einem Ständer das achteckige Taufbecken;
in ihm steht ein silberner Krug, in den das Taufwasser eingefüllt
wird. In den Rand des Beckens sind die Worte: "Lasset die Kinder
zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das Reich Gottes,
Evang. Marc.10,14" sowie eine Halbfigur von Jesus und kleinen
Kindern angebracht.
|
 Bibel
und Kerzen
Bibel
und Kerzen |
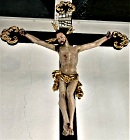 Altarkruzifix
Altarkruzifix |
|

Taufschale
|
 Kanzel
/ Ambo Kanzel
/ Ambo
|
Links neben
dem Altar sind die Lied-Tafel und ein Vortragekreuz
angebracht.
Internetseite
Die Evang.Luth. Gemeinde Kemmoden-Petershausen hat auch eine Internetseite.
Sie ist unter folgender Adresse zu erreichen:
"www.e-kirche.de/kemmoden-petershausen"
Hans Schertl

Quellen:
01)
Karl Fuchs, Annalen der protestantischen
Kirche im Königreich Baiern, um 1840
02)
Friedrich Schmidt, Pfarrbuch
oder allgemeine Beschreibung des gesamten Kirchenwesens in dem gemischten
ständigen Pfarr-Vicariat
Kemmoden, 1836
03) Gerhard Hanke / Wilhelm Liebhart,
Der Landkreis Dachau, S. 122, 1992
04) Ulrich Schneider, 1100 Jahre
Jetzendorf, Beitrag "Zur Geschichte der ev.luth. Gemeinde Kemmoden",
1993
05) Thiel/Mecking, Chronik der Gemeinde
Petershausen, Band 2 Kunst und Kultur, 2000
06) Süddeutsche Zeitung 2001/Nr.
283
07) Susanne Pfisterer-Haas, Festvortrag
zum 175. Jubiläum der Kirche von Lanzenried am 17. Mai 2015 (Schmidt)
08) "Die Glocken", Texttafel
in der Kirche, 2017
09) "Die Pfarrer und Vicare
von 1828 bis 2003 ", Texttafel in der Kirche, 2017
10) Friedrich Wiesender, Kirchenführung
am 2.9.2017
11) Petra Schafflik, Renovierung
dringend nötig, Dachauer Nachrichten vom 14.2.2021
13 Bilder: Hans Schertl
18.2.2022

|
Die
Pfarrer von Kemmoden
09)
|
Pfarrer + Vikare |
ab
|
|
Pfarrer
+ Vikare |
ab
|
Georg
Bauer (aus Nürnberg)
erste Predigt am 8.11.1829 |
1829
|
Vikar
und Verweser Gg.Wilh.Heydner |
1901
|
| Gg.Heinrich
Aures (aus Erlangen)
|
1832
|
Vikar
Julius Cohen (aus Regensburg) |
1922
|
Joh.Friedr.W.C.Schmidt
(aus Creußen)
zunächst Verweser |
1834
|
Gustav
Kramer |
1930
|
Heinrich
Leibig (aus
Sulzbach/Opf)
an Schwindsucht gestorben |
1838
|
Friedr.Wilh.
Walter |
1932
|
| Gg.
Christian Seyferth (a.Wunsiedel) |
1840
|
Hermann
Schläfer |
1951
|
| Pfarrer
Schick |
1852
|
Pfarrer
Herbert Windhövel (aus Schney) |
1961
|
| Vicar
Schmidt |
1857
|
Pfarrer
Oberthür
(zugleich Pfr.von Oberallershs.)
|
1964
|
Pfarrer
Riedelbeutel (aus Arzberg)
blieb nur 1 Monat, weil er im Febr.1863 Pfarrer
in Kartendorf wurde |
1863
|
Pfarrer
Eberhard Mehl |
1964
|
| Pfarrer
Josef Pöppel (aus Karlsfeld) |
1863
|
Vikar
Rainer Menzel |
1975
|
| F.O.Hoffmann
(aus Gesell) |
1869
|
Pfarrer
Hans Auner (aus Oberstdorf) |
1977
|
| Pfarrer
J.Richter |
1874
|
Pfarrerin
Beate Schörner |
1985
|
| Vikar
Rudolf Kern (aus Uffenheim) |
1881
|
Pfarrer
Bernhard Götz |
1989
|
| Pfarrvikar
Karl Düls |
1882
|
Hans-Joach.
und Susanne Scharrer |
<2003>
|
| Pfarrvikar
Georg Werlin (aus Augsburg) |
1884
|
|
|
| Vikar
Adolf Lindner (aus München) |
1885
|
Pfarrerinnen
Katharina Heunemann
und
Simone Hegele
|
2014
|
Pfarrvikar
Otto Leonhard Schroth
(aus Erlangen) |
1889
|
Pfarrerin
Elisabeth Schulz
und Pfarrer Robert Maier |
2017
|
Pfarrvikar
Michael Dannenbauer
(aus Beyerberg) |
1895
|
|
|
Pfarrvikar
Fritz Bauer (aus Neu-Ulm)
danach in die Mission |
1899
|
|
|
| |
|
|
|
|

|
|
![]()